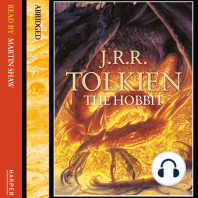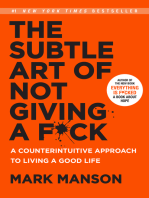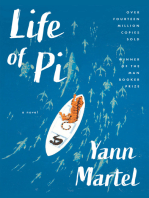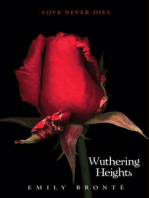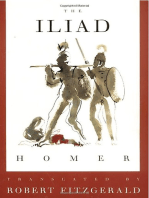Professional Documents
Culture Documents
Ernst Bloch - Philosophie Der Musik
Uploaded by
Eduardo PatricioOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Ernst Bloch - Philosophie Der Musik
Uploaded by
Eduardo PatricioCopyright:
Available Formats
-- - -- .
_------
Ernst Bloch
Zur Philosophie der Musik
Suhrkamp Verlag
Erste Auflagc dieser Ausgabe 1974
© dicscr Ausgabe: Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1974 Aile Rerhrc vorbchalten
Drucie Poeschel & Schulz-Schomburgk, Eschwege Printed in Germany
INHALT
Philosophic der Musik 7
Zur Dreigroschenoper 165
Zeitccho Stravinskij 168
Rettung Wagners durch surrealistische Kolportage 176
Uber die Melodie im Kino 185
Nochrnals die Melodieschicht im Kino 189
Lehar - Mozart 192
Mangel an Opernstoffen 196
Einfahrt und Ouvertiiren 201
Zaubcrrasscl und Menschenharfe 202
Uber Beckrnessers Preislied-Text 208
Sachsens Anrede an den Flieder 214
Paradoxa und Pastorale bei Wagner 218
Ober Hoffmanns Erzahlungen 256
Die Zauberflore und Symbole von heute 261
Uber das mathcmatischc und
dialektische Wesen in der Musik 267
Ubcrschreitung und intensitatsreichste
Mcnschenwelt in der Musik 280
Nadnueise 334
Philosophie der Musik
TRAUM
Wir horen nur uns.
Denn wir werden allmahlich blind fur das Draulicn.
Was wir sonst auch gestalten, fuhrt wieder urn uns herum. Es ist nicht genau so ohne wei teres ichhafl, nicht genau so dunsrig, schwebend, warm, dunkcl und unkorperlich wie das Gefiihl, irnrner nur bei mir, immer nur bewulit zu sein. Es ist Stoff und fremd gebundenes Erlebnis. Aber wir gehen im Wald und fiihlen, wir sind oder konnten sein, was der Wald traumt, Wir gehen zwischen den pfeilern seiner Stamrne, klein, seclenhaf] und uns seiber unsichtbar, als ihr Ton, als das, was nicht wieder Wald werden konnte oder auGerer Tag und Sichrbarkeit. Wir haben es nicht, das, was dies alles urn uns an Moos, sonderbaren Blumcn, Wurzeln, Stammen und Lichtstreifen ist oder bedeutet, weil wir es selbst sind und ihm zu nahe stehcn, dern Gespenstischen und noch so Narnenloscn des Bcwuiitseins oder Innerlichwerdens. Aber der Ton brennt aus uns heraus, der gehorte Ton, nicht er sclbsr oder seine Formcn. Dieser aber zeigt uns ohne frcmde Mittel unsern Weg, unseren geschichtlich inneren Weg, als ein Feuer, in dem nicht die schwingende Lufl, sondern wir sclbcr anfangen zu zittern und den Mantel abzuwerfcn.
ZUR GESCIIICHTE DER Musnc Wie horcn wir uns zuerst?
Als eridloses vor sich Hinsingen und im Tanz.
Diesc bciden sind noch namenlos. Sie leben nichr an sich und nicmand hat hier personlich geformt. Sie besitzen, wo man sie vorfindet, den Reiz des ursprunglichen Anfangens. Doch erst muGtc man durch Anderes hindurch, das den Ausdruck breit und fest z.uriisten licK
7
Ani dng«
Dies stieg nur mahlich herauf. Auch ist von den friihesten Weisen sehr wenig noch bekannt. Nicht einmal die griechischen Lieder sind umfanglicher crhalren geblieben.
Was uns davon noch erreicht hat, ist meist reizlos und leer. Ebensowenig kann man sich von dem Klang der griechischen und fruhmittelalterlichen Kapellen eine besonders giinstige Vorstellung machen. Aile Spicier muliten sieh auf den einen Gesang beschranken, Hochstcns, daB es erlaubt war, unten den Grundton und die Quinte, die Dudelsackquinte, zu der Tonart anzuschlagen und weiterklingen zu lassen. Auch der Kirchengesang verharrte in der Enge der Einstimmigkeit. Er wurde zwar schon fruhe durch die Responsorien der Gemeinde gegliedert. So mag er, in dem cindringlichen Psalmodiercn, in den zahlreichen Vokaliscn unci Jubilationen dcs ambrosianischen und gregorianischen Meloclienbuchs, in der Vcrzierung seiner einfachen, Feinen melodischen Linie, nicht zuletzt in der wahrhafl: basilikenhafl:en Festigkeit dieser Chorale, fiir die Gemeinde rnehr bedeutet haben als dies aulierhalb der religiosen Verziickung noch nachzuerleben ist.
Denn im ganzen ist das alles erloschenes Gut. Nicht viel anders steht es mit der spateren, mit der rnehrstimmigen Musik des Mittclalters. Nur die fahrenden Sanger beginnen neu zu erfinden. Sie sind ungclehrt, auch darin, daB sie zuerst von allen rnehrstirnmig zu setzen wagen. Es war wenigstens cin Harfenschlag, der dem Troubadour auch in den Zeiten der strengsren Einstirnmigk eit zur erlaubtcn Verfiigung stand. Dazu kommt, daB die Harfe, die zum freien Umspielen als einem gesondert horbaren Figuriercn der Melodie nicht tauglich ist, von seiber zu akkordlichen Verschmelzungen hinleitet. So lebt hier nicht nur die freiere Bewegung un d das Bedilrfnis des Ausdrucks, sondern auch unabhangig und weir entschiedener als bci den bloE verstandigen Versuchen cler damaligen Harmonisten, die die Troubadours aus der Schule verbannten, eine deutlich erkennbare Annaher ung an die Dur- und Molltonarten und Ausweichungen der sparercn Zeit. Aber das Gute daran ist verloren gegangen oder durch die spateren, verwandten, durchaus groEarrigeren Meister der italienischen Cantilene iiberflilssig ge-
8
worden. Was andererseits die gleichzeitigen Versuche der Mchrstimmigkeit angeht (und sie geschahen nur in der europ.iischcn Musik), so kommen sie im wesentlichen, selbst in der Musik des spateren Mittelalters, iiber den Zustand der blof theoretischen Vorarbeit auEerhalb der kiinstlcrischen Werkgesinnung nicht hinaus, Wenn die gclehrten Monche auch allerlei gefunden haben: Hucbald und die ersre Ahnung des Zusammenklingenlasscns der Tone, Guido von Arezzo und die Anfange der genaueren Notenbezeichnung, Franco von Koln und die aus der Gewohnhcit, mehrere Tone bcirn Diskantus gegen einen zu singen, stammende Mensuralnotenschrifl:; so bleibt dies alles doch blolier Schulkram, dessen innere Verdiensre nicht mehr recht z u ermessen sind, sofern die Einfiihlung in die clamaligen sachlichen Schwierigkeiten nicht mehr zu leisten ist, und die eigentliche Kunstfertigkeit, auch im Sinn dcr Theorie genommen, durch die nachfolgende, bereits neuzeitliche Epoche der Niederlander weit iiberbotcn wird.
Aber auch bei ihncn ist der Blick noch leer. Man denkt hier vor allern an den bcdeutenden Josquin. Es gibt von ihm gewiE kleinere Stucke voll ubcrraschcnd inniger, durcha us auf das Beseeltscin der Stimme gestellter Wirkung. Aber wie trocken wird iiberall dort das Brot, wo es anspruchsvoller nahrt, wie hart bleibt die Stimmfiihrung, wie unsangbar, ausdruekslos und melodienlos ist noch Dufays oder Ockenheims kiinstliche und bewunderungswiirdige Sarzkunst. Einflufslos stcht der Text da, und fruchtlos bleibt die ungeheure Verstandcsarbeit in sich selbsr verschlossen. Es ist der Bleistifl, der seiber rechnen modite. und der verschlungene Achrer, dcr nichts trifft. Es ist cine Schaupartitur von unerhortern Rang, die beim Anhoren riner gewisscn schwicrigen Macht nidit entbehrt haben mag, die abcr im wesentlichen nur die technische Zuriistung zu einem ganz andcrsartigcn Baroek bedeutet. Hier mulitc cin Stof von unten kommen, der einfach werden lief und den eirlen Kalkiil der Partituren auf die Orte der seelischen und textlichen Notwendigkeit zuriickfiihrte. Erst dadurch konnte Luthers Wort:
"Die andcren Sangesmeister miissens machen, wie es die Noren haben wollen, aber Josquin ist der Noren Meister, die haben's rniissen machen, wie er wollt« - in dem schonen, gegcnformalen Sinn dieses Sa tzes erfiill t werden.
9
Der neue EinfluB kam vorn Volkslied. Wurde es drei- bis sedisstimmig gesungen, so erschien es als Madrigal. Da auch dieses leichten, meist erotischen Inhalts bIieb, so trieb das urspriinglich Liedrnaiiige daran stark in die sangvolle Oberstimme. Bald darauf werden auch die alten Tonarten chroma tisch durchbrochen. Es war der Nicderlander Willaert, der bezeichnenderweise unter italienischem EinfluB zuerst chrornarisch und in der neuen Teilung des Dur- und Mollakkords schrieb. Er sctz te an die Stelle des bisherigen, fcincn, vielfach sich verschlingenden Stimmengewebes den deutlich als gleichzeitig fixierten Akkord und cntdeckre so, wie die Venezianer sagrcn, das »aurum potabile«, also die neuen Moglidikeiten einer harmonischen Musik mitten in der noch rein kontrapunktischen Zeit. Nicht viel spater brachtc Hamer den neuen harmonischen Ton mit nach Deutschland, urn seinen Glanz in die mehrsrimmige Bearbeitung des protestantischen Kirchenliedes einzufiigen. Hier trat der Gesang endgiiltig an die Obcrflachc, das heiBt, der cantus firmus, der [riiher im Tenor, also in einer Mittelstimme stand, wurde in die Oberstimrne gcsetzt, urn so die iibrigen Stirnmen, die nun zu Fiillstimmen wurden, irnmer cntschiedener dem Diskant als dem Trager der sangvollen Hauptmelodie unterzuordncn. Das geschah vorerst am zweckmaBigsten, indem die begleitenden Stimrncn moglichst gleichmaBig mit der Oberstimme in einer gleichzeitigen Harmonie weiterschreiten, anstatt daB jede Stimme, ex cantus firmi una voce plures faciens, ihre selbst.indigcn, durch Nachahmung, Umkehrung, Krebsgang oder die anderen kanonischcn und kontrapunktischen Vorschriften geforderten Wege ging. Und nun, von Orlando ab, ist die volle Freiheit gewonnen. Er beherrscht das Trinklied nicht weniger meisterlich als den Ernst seiner erschiitterndcn Buf psalmen, alles ist in groBter Breite zum Ausdruck bcreit geworden, das tonale Haus ist gebaut, die ganz eigentlich erst »musikhallc« Weite, Perspektivik , Transzendenz des Tonraumes vorgebildet. Die einzelnen italienisch melodischen und niederlandisch kontrapunktischcn Stilweisen verschmelzen mitcinander und geben dern dadurch erst mit Leidenschafl: und absichtlicher Subjektivitat errcichten Ausdruck die erwiinschten Mittel an die Hand. Nun ist jede Harte, Einseitigkeit und Alternative voriiber: der Kampf des trouver mit
10
dem construcr ist auf lange Zeit ausgekampfl, durch das Subjekt Orlando so vollig und entscheidend, daB von hier ab alle Stimmen singen und Troubadour und Schule vereinigt sind. Dadurch kann sowohl das Erste, das Melodische (das hier noch iiberwiegend aus der Tonlciter und nicht aus dem Akkordleben starnmt und deshalb wieder weniger nach der Harmonie als nuch der vielfachen Einreihigkeit des Kontrapunktierens verl.mgt) wie das Zweite, der Kontrapunkt seIber, dieser alte, ehcmals um die Schonheit seines melismatischcn und thematischen Materials so unbekiimmcrte Kombinationskalkiil, ihre volligc Vereinigung in der Freude des Musizierens erleben. War indes Orlando eine Rernbrandtsche, so ist Palestrina eine Raffaelsche Natur, Bei ihm sind die Tone stiller geworden und mit der herrlichsrcn Neigung zum mehr akkordischen Zusarnmcmrcffen lind Ausruhen gcfiihrt. Wie hier die wenigen Menschcnstimrncn gruppiert werden, bald, in den romischen Choralcn, zur innigsten harmonischen Schlichtheit zurudcfiihrend, bald wieder, wie sein Stabat Mater und noch mehr die beriihmtc Missa Papae Marcelli beweisen, in die Raumgewalt dcr Tongange, der sich selbst homophon kolorierenden Tong:inge hincinfiihrend: das ist bereits so auBerordentlich harmonisch, nicht harrnonisch-dramatisch, sondern harmonisch im Sinn des noch rhythmusloscn Seraphischen gedacht (ein Teppich fur Bruckner und den spaten Wagner), daB nur mehr das akkordische Horen, also das unten vertikale und allcin noch oben, wo sich der Gesamteindruck des Melodischen zutragt, horizon tale Vereinheitlichcn als die adaquate Erfassung dieser Kornposirionen gelten kann. Darnit haben Orlando di Lasso lind Palestrina als die erst en musikalischen Genies den Aufbau der Schule als Sclbstzweck widerlegt. Der melodische Ausdruck, die Melodic isr zum einzigen Inhalr, bei Orlando der leidenschafllicheren, uberwiegend linear sdircitcnden, bei Palestrina der frommercn, iibcrwicgend akkordisch zusamrnengehaltencn Kontrapunktik erhoben.
I I
Das Verfahren
Man darf darum von hier ab nicht mehr eng sein. Denn alles, was handwerklich ist, r iickt jetzt in die zweite Reihe. Der Ton steht fest, der Herd ist gegriindet. Was nunmehr kommt, ist nicht damit erledigt, daB man es technisch beherrscht. Es kann einer ein tuchtiger Musikant sein, und alles bleibt trotzdem tot, weil der bloBe Handwerker gerade vor dem konfus wird, was das Handwerk erst lohnt.
Das handwerkliche Nacheinander
Dazu zwingt uns noch ein Anderes, sehr lebendig zu werden. Es ist klar, daB auch bedeutenderen Kiinstlern gegeniiber nichts so sehr abschwacht als das Einlegen oder Hineinrichten in irgend ein Nacheinander der handwerklichen Entwicklung, in die Geschichre der bloiien vermittelnden, befestigenden, technischen Formeln. Wie langweilig ist dern, der das nicht kennt, und vielleichr noch mehr dern, der es kennt, jetzt die Hoffmannsche Undine geworden, nachdem Weber dieses al les, mag er noch so viel von dem friiheren Werk instrumental gelernt haben, im Freischiitz sehr viel besser macht. Wie unangenehm konnen aber auch bei Weber selber die damals neuartigsten Harmonisierungen klingen, vor all em in der Euryanthe, so fern man nicht beim Anhoren den aufdringlichen, sinnlosen Gedanken an ein Plagiat aus Lohengrin unterdriicken kann. Was einmal erfunden ist, hat flir sparere Zeiten jedes Interesse und jede Nacherlebbarkeit des urspriinglichen Interesses im Problemzustand oder frischen Geburtszustand verloren, sofern es nicht mehr als ein technisches Problem war; das wahre Sosein der groBen Musiker wird also durch die Geschichte der musikalischen Technik nicht bestimmt. Sonst waren die Vorganger fast jene Hauptsache, die nichr in ihnen drin ist, die sie formanalytisch unerschopfend vorbereiten. Je mehr groBe Meister der vorhergehenden Regel verdanken, desto genauer sind sie gerade nicht im Handwerklichen neu, sondern in dessen hddist eigener Verwendung. Soil man eigens erst sagen, daB Mozart ohne die Mannheimer und die opera buffa nicht denkbar ist? Ist es die Regel oder nichr vielmehr dies, was er daraus machte,
12
wodurch Gluck der altflorentinischen und altfranzosischen Oper iiberlegen ist? MuB man noch gesondert hinzufligen, wie sehr gerade Bach am Alten hing, wie deutlich er sich von der immer weicher gearteten Harmonie der neapolitanischen Schule nur abkehrt, urn start Scarlatti die alten Nieder lander und Irn liencr zu rezipieren? Auch dieses geschah iibrigens durchaus mit Bewahrung eines gewissen bel canto, die Tanz e und Chansons spielcn formell eine grolse Rolle; und was das andere, das Satztechnische angeht, in dem Bach mit einer fast an Brahms erinnernden Reaktion auf die Vergangenheit zuriickgreift, so ist cr eben nur der Art der Verwendung und nicht auch der Satztechnik nach irgendwie der kontrapunktischen Gelehrsamkcit der alten Meister iiberlegcn. Noch sonderbarer sieht es bei Beethoven aus, desscn neue Art durchaus nicht technisch neu ist, Denn cs sind viele Fliisse gewesen, aus denen die Senate zusammcntloii, und mag auch Haydn zuerst dieses mehrthematische Gebilde als Werk geschaffen haben, so ist doch lehrreichsr, daB gerade dieser objektiv stille Meister als Vater des Umsturzcs weiterlehr, genau so, wie er weit mehr als Beethoven die technischen Experimente liebte, Wogegen Beethoven selber, der Schiller Haydns, iiberhaupt nichts Technisches vorFand, gegen das er aus Griinden seiner bestimmten musikalischcn Art zu rcvolutionieren gehabt harte.
Hier gibt es also nichts einzuordnen und irgendwie »fortschreitcnd« aufzubauen. Die grolien Ichs sind unvergleichlich und wahrhaft zu andercm als der technischen Schnur geboren. Man brauchr nur an das h.imische Ceschwatz Hanslicks zu erinnern ctwa tiber ~luck, gegen den Mozart, oder iiber Mozart, gegen de.n Ros.slnl, oder tiber Rossini, gegen den Meyerbeer ausgespielt wird. Dann wird man begreifen, wie in diesem irnmer nur technisch gehaltenen gegeneinander Ausspielen der Musiker emr; For~11el der Gcrncinheir und flachsten Rcspektlosigkeit gegeben ist, vor allem dann, wenn, wie hier, der Kritiker an dcm Punkt, wo es am entschiedensten modern zugeht, plotzlich den Wagen anhalt, den Grundsatz banalen Fortschritts bricht und i~ seiner allein konsequent gebliebcnen Gemeinheit zum Aussplclen aus der Geschichte zreifl. Wenn niemals ihrcr zwei z~gleich singen, so hat das im Rheingold seine Grlinde, die nur hler vorkommen; und Tristan geht in dcm, worin er wesentlich
13
ist, so wenig auf die altflorentinische Monodie zuruck, wie umgekehrt Don Juan etwa ein maBiges Musikdrama ist, Denn die Anderen, statt Hanslick, waren nicht viel besser, und wenn man sieht, auf welche Weise die armlicheren Wagnerianer aile alten Meister der rezitativischcn und ariosen Oper nur als mehr odcr minder unbegabte Vorganger eines Wagnerstils zu rangieren beliebten, der sogar und gerade die neunte Symphonie iiberfliissig gemacht haben soli, dann wird man aus seinem Widerwillen erkennen, dal] das geschichrlich handwerkliche, technische Einreihen vor allem Wesentlichen der Musikgcschidrte versagt, ja sogar das Unverglcichliche der sich verrnittelnden individuellen Lebendigkeit noch eindringlicher sichtbar madre, als dies ohne den Versuch einer rein technisdi-Iorrnalen »Aufbaulehre« moglidi ware.
Der soziologische Zusammenhang
Es gilt hier vielmehr, jedem wahrhaft grofsen Meister ein ichhaftes Haus zu bauen, in dem er fiir sich als bestimmter »Zustand« noch jenseits seiner Talente wohnen kann. Hierin ist er frei, bringt lediglich sich seIber seelisch ein, So ist das sclbstredend auch noch ein anderes als das, was gerade unter den Menschcn umgeht, was lediglich zeirgenossisch verbindet, Es ist aussichtslos, hier etwa, nachdem das Handwerkliche versagt, mit Kettenbildungen, mit dem, was einmal ahnlich war, oder anderen vergleichenden Hilfsmitteln vorwarts zu kommen. Nur die kleinen und mittleren Meister haben gewisse malerische oder dichterische Kollegen, als welche mit ihnen leben und dassel be anders aussagen. Vielleicht isr Nicola Piccini rokokohaft, aber es ware oberflachlich zu behaupten, dag Gluck dem Louis seize, oder Mozart dem ostcrreichischen Rokoko, ode! Beethoven dem Empire, oder Wagner - nun, wem oder was konnte Wagner ersdiopfcnd mitfolgen? Halb wenigstens hat dies Nietzsche gefuhlt, als er lehrtc: »Die Musik kommt als die letzte aller Pflanzen zum Vorschein. Ja, mituntcr lautet die Musik wie die Sprache cines versunkenen Zeitalters in eine crstaunte und neue Welt hinein und kommt zu spat. Erst in der Kunst der niederlandischen Musiker fand die Seele des christlichen Mittclalters ihren vollen Klang. Erst in Handels Musik
14
erklang das Beste von Luthers und seiner Verwandten Seele, der groBe judisch-heroische Zug, welcher die ganze Reforrnarionsbewegung schuf. Erst Mozart gab dern Zeitalter Ludwigs des Vierzchnten und der Kunst Racines und Claude Lorrains in klingendem Gold heraus. Erst in Beethovens und Rossinis Musik sang sich das achtzchnrc Jahrhundert aus, das Jahrhundert der Schwarrnerei, der zerbrochenen Ideale und des fliichtigen Glucks.« AuBcre Umstande rndgen gewif dieses historisdi ticf Ungleichzeitige noch unterstiitz.t haben: denn Freilich dodi ist Bach erwa zum untcrsten Teil noch »soziologisdi« zu verstchcn aus dem, gegen den Westen gehalten, »zuruckgebliebeneren- Deutschland, dessen Bucheinbande sogar, mitten unter den clcgantcn Formaten der Renaissance, ja des Rokoko, ihr mittclalterlichcs, foliantenhaftes Aussehen bewahrten; und so auch hielt sich, unter all dem Triumph der konzertanten, homophon individuellen, emanz.ipierten Einzelstimme, in Deutschland lange nodi Stimrnigkeit, organischer Gliedbau, verdrangtcs Linienziehen im Unsichtbaren und spatgotische Frornmigkeit als sein Licht. Indes eben, all dieses »Erklaren« von aufsen her bleibt selbcr lctzthin aulserlich, macht die Gesarnterscheinung, die tiefe historische Einsarnkeit, die soziologisch uneinbcziehbare Seinsebene Bachs nicht begreiflich; noch ganz davon abgesehen, dag auch Nietzsche, wo er die historische Ungleichzeitigkeit der Musik erfafsr, diese doch allzu stark zum blogen Revenant werden laBt, sic selber noch allzu historisch auf Verga ngcncs bez iehr, statt sie von der ZukunA: her zu er leuchtcn: als Geist ut opiscben Grades, der sich demgerna S, wenn auch mit zahllosen W~hlverwandtschaA:en und freien Rczeptionen, mitten 111 Geschichte und Soziologie lediglich sein eigenes Haus, das Gefiige seiner eigenen Entdeckungen und inneren Seinscbcncn baur, Da bleibt sonderbar genug und die universalhistonsche Anomalie iiberhaupt, daf die Griechen und mittel~Iterlichcn Menschen fast stumm geblieben sind, daf plotzlicli B~ch In den Tagen Watteaus, oder auch Tiepolos, als der Erbe cincr sicbenhundertjahrigen Vergangenheit erscheint, ein dunkl--, iippiger, verwirrender, vieler Orts gotischer Meister, und daB die so sehr junge Musik, eine fortdaucmdc Synkope selbSt der neuzeitlichen Gcschichte, ganz sichrbar einem anderen Rhythmus als dern des ihr zugehorigen, rnorphologisdi,
15
soziologisch gegebenen Kulturkorper gehorcht. Wi, Beethoven ·1 nur aus sich rollt, wie Mahler schon augerlich seine achte Sym-' phonie fur eine andere Gesellschaft gcwisserrnafsen vorausge- i schaffen hat, so erdenkt sich auch Wagner Evchen und das Yolk I auf der Festwiese, ein selbstgewahltes, vom Kiinstler selbsr als ' inspirativ gesetztes, utopisches Bayreuth, fernab aller zeitgenossischen Soziologie, ihren Inhalten und ihrem Formwillen. Wenn sich also ein Musiker von dem Willen seiner Zeit dararr unabhangig fuhlen konnte (und es ist etwas GroEaniges und Geheimnisvolles, daE gerade die beiden groEten Musiker des neunzehnten Jahrhunderts Revolutionare w aren), dann ist es sicherlich auch nicht das Wesentliche, das, was iiber Mendelssohn, Schumann und das blof Formelle hinausliegt, welches an der Musik okonomisch und soziologisch eingeordnet werden kann. Der irrt also, der die in allem Anderen so wohltatige wirtschaftliche oder sonstwie vereinheitlichende Betrachtung nach dieser Seite verabsolutieren mochtc, Was dem Wasser niitzt, rnuf dem Feuer schaden, ja es kann sogar dieselbe Kraft sein, die im Wirtschaftlichen, im Staatslebcn alles zur Hohe treibt und in dem reinen Werkleben Unheil iiber Unheil sriflet, Wer es anders meint, wer das Verschiedenste in den cinen historisch-soziologischen Trab hinbringen mochtc, urn zwanzigspannig zu fahren und das Ungleichzeitige, ja spharisch Unvergleichbare dennoch in eincm einzigen epoehalen Zugelgrifl zu vereinigen, dcr wird desro oberflachlichcr, gotrverlassener werden miissen, je energischer sich die Sache anlaEt und je iiberraschendcr sich jene Bewegungen gegenseitig zu erlaurern scheinen, die so homogen in den genetisch polyhistorischen, in den universalhistorischen oder auch morphologisch synoptischen Degriff eingegangen sind. Wir konstatieren also, dag weder die einzelnen negativen, das heiEt nichts zwingenden, inhaltlich kausal unkrafligen Bcdingungszusarnmenhange okonomischer Art, noch die zwischenmenschliche Beziehung, mit dem Staatsleben als der einzigen Objekrivitat und der deutlichen inneren Kompetenzbeschrankung ihrer ewigen »Soziologie des -", irgendwie die Gcschichtsabschnitte und Soziologien der Musik so geben konnen, daE darin etwas aus der eigentliehen Entwicklung und Sachlichkeit dieser Kunst, als eigener Sphare genomrnen, ausgcsagt wird. Nur dort ist es moglich, uberwie-
16
gend sozial herzuleiten oder. gar ga~z e!nzusch~ieEen, wo die zwischcnmcnschlich, das helEt sozial intcressier te Betrachtungsweisc mit ihrem Gegcnstand, also etwa der Sitte als einer gesiliehenden zwischenmenschlichen Beziehung oder der Wirtschaft, dern Recht und dem Staat als seiner Form der zwischenmenschliehcn Beziehung, zusammenfallt, Wo es nicht so steht, wo cs unrnoglich ist, mit dem Staat zu schliefsen und die andcrcn Werte, wie Kunst, Religion, Wissenschaft und Philosophie als die hochsten Bliiten des Staatslebens zu homogeneisieren, bleibt das wesentlich Intendierte daran anders, iiberschielsend geglicdert, urn gleichsam nur vor einem apriorischen Zuschauer zu leben und so fur seine groiien Vertreter, Stoffe und Werke die etns amc , gcschlchtlicb exzentrische Typisierung nach apriorischen Wirkungs- und Sachproblemen zu fordern. Gewif ist aueh das cinzelnc geniale Tun nicht vollig unableitbar: aber das ist ein anderes als die Gesinnung einer mehr als gegenwartig vcrcinheitlichten Menschengruppe, wenn, wie hie und da in Griechenland und im Mittelalter, der Zeirwille und der Geniewille wie durch geheime Verabredung zusammenstirnmen; wenn sich die groEen Individuen plotzlidi in einem sonderbaren Auf und Ab der gleichen Linie befinden; wenn sich tiber ihnen Einfliistcrungen vernehmen lassen, denen ihr Ieh gehorcht, und iiberindividuclle Botschaften, die die Formung ihrcs Wcrkes determinieren ; wenn sich die gcniale Sobestirnrntheit 7U einer Chiffer fur einen iibergeschichtlichen kanonischen Diapason verwandelt; wenn sich also cine aller wirtschaftlich soziologischen Pragmatik oder morphologischen Synoptik weit entlegene, wahrhaft »geschichtsphilosophische« Beziehungsreihe auftut, in der die groEen Individucn zu Kategorien werden und die ganze Geniefolge, vorab die der Musik, zu einem das Bewu~tsein unserer selbst, das Bewulitsein Gottes von sich selbsr betreffenden Kategorialsystem iiberzugehen beginnt.
Die sprengende Jugend der Musik
Hicr aber ist man seit langem unbeschadet immer wieder jiinger geworden. Und es ist nicht das Konnen und die Reife, sondcrn nur die Schule, die dabei verschwunden ist, So ist gewill, daE auch von hier aus das gewohnliche Lobpreisen der
17
alten Zeit in allen musikalischen Angelegenheiten zuschanden gehen mufl. Zwar pflegen selbst die neuartigstcn Bilder nachsichtiger beurteilt zu werden als die jeweils modernsten Satzarren, Aber das Entsetzen ging bald voruber, die Ohren, die man sich beim ersten Anhoren des Figaro allen Ernstes mit Eisenblech gefiittert wiinschtc, fanden bald die neue Gewohnung, und der Streit urn die Grundsatze des Schoncn und Melodischen war rasch geschlichtet, sobald man der eigenen Spur verges sen erst einrnal die Regeln des ncuen Gebildes aufgesucht und verstanden harte. Das Handwerk ging weiter, kleine Formen zerbrachen, expressiv noch tiefer begriindete Form kam herauf, und der Ausdruck stieg, so deutlich, dag etwa der Verfall und der dann kraftig einsetzende Aufschwung des Malcnkonnens im neunzehntcn Jahrhundert fiir die Musik iiberhaupt nicht gilt. Wie wenig hier das blog Alte bedeutct, lagt sich an zwei Fallen geniigend erkenncn. Wenn ein junger Mann den Zauber finden 5011, der ihn von dem Selbstmord abbringt und aile verlorenen Lebenskrafle zuriickgibt, dann braucht Balzac als Umgebung dieses wunderwirkenden Chagrinleders rcchtens einen ganzen Antiquitarenladcn mit dem Gewoge von Moden, Erfindungen, Mobeln, Gebilden und Triimmern der Vergangenheit. Wenn es sich dagegen urn drei Wiistlinge handelr, die sich mit einer Menge verwogenen Gesindels zusammengetan haben, urn die Nonnen zu schanden und daneben Bilderstiirmerei zu rreiben, und nun die heilige Cacilie seiber zur Rettung ihres Klosters ersdieint, so wirkt es ziemlich sinnlos, ja eigentlich musikalisch laienhaft, wenn Kleist dort, sehr betont, eine uralte italienisdie Messe auffiihren lagt, wo cin damaliges Stiick von Palestrina besser geniigr harte, ja so gar, falls man das Anachronistische ausschaltet, cin Satz aus einer Brucknerschen Symphonie nods magischere Dienste geleistet harte, Dies eben ist das Wesentliche: daf man Freilich alles, was zu Balzacs Zeit bildnerisch gestaltet wurde, verlassen oder wenigstens ins Aternlose iiberstiirz en mug, soli es als Folie zu bedeutenden Dingen Iungieren, wahrend die ton en de, musikalisch gegebene Gegenwart jedem nur denkbaren Abenteuer und Wundergeschehen nahe verwandt sein kann. Insofern fliegt der Musik nidit nur im selbstverstandlichen Handwerk, sondern auch in der Kraft des personlichen Ausdrucks ein einziger Strom von Ebenbiirtigkeiten,
18
der unberiihrt von allem Auf und Ab ~leibt, der Bach .und noch in ganz anderer, erstaunliche:er Wel~e W~g~er unzeltg~mail machte, und der im Ganzen jeder zeirgcnossischcn MUhSI.k mindestens den gleichen hohen, sonst nur in der Vergangen eit auffindbaren Grad der Phantastik errnoglicht.
Aber nun, e eht dieses bessere Neue am Ton richtungslos weiter? Ist das bliihenc!e Klangleben, als mehr denn je in sich spiclendes, nicht etwa der Ausdruck dafiir, daf man das obere, das sich ans Objektivc kniipfende Band verloren hat, dessen flatternde und fallende Enden nun freilich in der Subjektivitat noch einize Zeit zu sehen sind? Und zwar desto deutlicher zu sehen sind, je naher sie zum Boden kommen, jc enger sich also Fall, Lebhaftigkeit und Endc benachbart sind? Liegt vor allem in der ganz ratselhaflen Tatsache, daf die Musik immcr jiinger, imrner unccbundcner und weitraurniger geworden ist, auch cine Garnntie [iir ihre Unerschopflichkeit und zeitgeistige Irnmunitat? Vieles scheinr sich zu vereinigen, urn gerade diese letzte Fr agc zu bejahen, aber freilich nur urn den Preis, d~g damit zueleich eine Reihe von Bedenken cingeftlhrt wird, die, wenn sie auch keineswegs das gcwohnliche Lobpreisen der alten Zeit in den musikalischen Angelegenheiten rechtfertigen, so doch das bloge leere, systemfreie Jungsein der Musik problematisch macht. Wir sagten zwar bereits, das Konnen des Schopfers nimmt durchgehends an der hier selbstverstandlichen Sorgfait des Handwerklichen teil, ja man kann sogar behaupten, dag die Kraft der melodischen Erfindung und die Liebe zum Einzelnen in der kammermusikalischen Stirnmfiihrung seit Beethoven gestiegen ist. Irides das alles steht irnmer wieder nur auf zwci Augen, auf zwei bildlosen Augen, es gibt weder eine Schule, noch die Feste geistige Schonhcit eincs rnusikalischen Stils, des cinzigen uns noch rnoglichen Stils, und die Musik will keinen Anfang nehrnen. Es gibt hier nur Kiinstler und keine Kunst: jec!och die einzclncn Kiinstler selber haben nicht ohne weiteres das Recht, fur sich schon kategoriell zu sein oder wenn auch, so cloch nur in der Weise, daB die dagewesenen und als Kategorien stchenden grofscn Individuen einen kategorialen Zusarnll1cnfcang gebildet haben, der den Spatergeborenen, unerachtct all ihrer herrlicheren jugendlichkeir, erst den Druck und Hair einer das Jungsein, Zukiinftigsein, Subjektivsein sub-
19
stanriell fundierenden Sphare verrnittclt. Weil sie tiefer gehen besitzen die Tongebilde das Jungsein nicht einfach als Eigenschaft, sondern sie werden gerade dadurch jiinger, daf sie alter werden und auf sich ruhen und das Neualte des Verborgenen dieser Ruhe erlangen. Sie schreiren rnithin als Kiinstler wie als Kunstwerke nicht sinnlos fort irn leeren, formalen Marsch der Zeit, sondern das Neue rundet sich, urn daran sein MaB und seine Strenge zu find en, es wird eine Wtirde, zuletzt cine Heimkehr, und am Ende ist es gerade das Waghalsigste, Schrnerzlichste, sich am meisteri Loslosende und Paradoxe, das dem Alten, uraltest zugrunde Licgenden, Einfachsten, Gegebenen, vorweltlich Ersehnten, in der erwachsenen Welt Verlorenen am nachsten stcht. Die der Geschichte der Musik fast durchgehends wesentliche Lockerung des Unwesentlichen und zunehmende Subjektivierung, Adaquation des Suchens und Abcnteuers, des Geistes der Neuzcit an sich selbst, zu sich selbst gehorcht audi in seinem Irnprevu und gerade in dessen Impressivem einem expressionistischen, aufs Wesentliche gerichtetcn Gedanken, einem Gedanken, der immer wieder das trouver tiber das construer siegen laEt. So bringt hier der nichr sterbende, nicht entsagende j iingling, der sich unaufhorlich erneuernde jfingling im Genie erst die Reife, aber eben durchaus die Reife mit sich, als welche die »jugend« erst substanziiert; und das Schweifen der Dissonanzen, das Anwachsenlassen der Steigerungen, ja auch die so anarchisch scheinende atonale Musik bilden in Wahrheit nur die untere Gegenbewegung eines oberen, darin sich durchsetzenden Expressionismus und der kaum erst in den Anfangen erreichten Wesensschau seines gotischen Oberschwangs. Doch das alles ist das, was es ist, eben nur vcrmoge seiner Richtung, seines Eingedenkens, seines geheimen Systems heraustretender, immcr mehr heraustretender, aus letzter Orthodoxie revolutionarer Jugend. Wenn der neue Ton also an sich schon der bessere ist, so ist er es gewiE nicht wegen seines glatten Gesichts oder wegen seiner nur die Abwechslungsbediirftigen reizenden Uberraschung, sondern weil die Zeit, die sich entwickclnde Ncuzeir, Adventszeit als Begriff gefaBt, den Musiker braucht und liebt,
20
Das Problem einer Geschichtsphilosophie der Musik Deshalb miissen die Tonenden, damit nichts zerflieflr, dennoch zusammen gehalten werden. Diese Bindung ist wohl ziehend, zielend, fortschrittlich gcarbeitet, aber nicht nur zeitlich, sondern mchr noch raumlidi gefaEt. Sie ist so gearbeitet, daB die einzelnen Punk te, die sie als Form beriihrt, durchaus als seiend fixicrr werden. So kommt es hier darauf an, bestimrnte geniale Idizustande zu fassen, die Iilr jeden, der mozartisch, bachisch oder heerhovenisch begabt ist, kanonisch werden. Aber dazu eben rnuf hier alles blof geschichtlich Zusammengefligte aufs griindlichste zugunsten eines neuen Ganzen des Oberblicks getrennt worden. Das Gegebene und scheinbar so different Gegebene ist umfangreich genug geworden, urn genau so, wie sich die grolscn Meister der verschiedenen Formen des Lieds, der Fuge oder der Son ate nach Belieben bedient haben, sofern es der »Gcist« der einschlagigen Stelle forderre, urn genau so auch Mozart vor Bach zu setzen, oder aus den Mozartschen, Bachschen, Wagnerschen Formen eine historisch uniiberholbare, jeweils wieder zu postulierende Reihe der Komposition und ihrcr Gegenstande zu bereiten. Rein zeitlich, also dem totschlagerischen Nacheinander gemaE genommen, sind Freilich die Unrerschiede ganz ungeheuer. Nirgends ist der Wechsel so eindringlich und vor all em der Zeitraum, in dem dieser Wechsel geschicht, von einer solch vehement en SchneIligkeit und Kiirze wie in der Musik, und nirgends ist die StraBe so hoffnungslos, oder wenn man will, so hoffnungsvoll geradlinig als in dieser Kunst. Oberall sonst gibt es Muster, das weithin, zerstreut Verwandte iiberwolbend, einmalige Erfassungen des Absoluren und Rezeptiven. Die griechische Saule, aber auch die gotische ~aule, das Homerische Epos, aber auch das Alte Testament sind solche Grundformen, nicht minder die Platonische Philosophic, aber auch die Kantische Philosophie; das heiBt, es geniigt hier aIs Erster das Gebiet mit Bedeutung betreten zu haben, urn damit in dem ersten zugleich ein unzerstorbares, mindestens teppichhaft erschopfendes Muster, einen gewissen Ring ~dcr cine gewissc Umzirklung, Invcntarisicrung der moglichen knhaltc gcgeben z~ hab7n. Doch erst .seit.kurzem, trotz der ge-
ommen en, jeweils wirkenden Orientierungsmafle Mozart,
2I
Beethoven, gar Bach, vollzieht sich das neue Ganze des besseren Oberblicks aucli in der Musik. Der Meister kann sidt nach wie vor als das aus sich rollende Rad fiihlen, aber die sinn lose Turbulenz des Fortsdirittsmaliigen ist verschwunden;. aus der Eitelkeit und der moglidist anarchischen Konkurrenz mit dem Vorhergehenden hebt sich ein Bau und eine Stelle aus dem Bau heraus, so daB jeder Gedanke im gesmichtli<h. gegebenen Forrnkomplex seinen bestirnmten Ort erlangen kana, der ja an der Stelle seines historischen Vorkornmens selbst] durchaus nom nicht erledigt zu sein braucht und sehr wohl das nom Bessermachen, die gliihendere Phantastik und das utopisehe Weiterdenken seines Gehalts fordert. Erst seit kurzern also, seit Brahms und nom vie! mehr seit Bruckner, scheint der letzte Anfang gemacht zu sein, scheint die rastlose Neuheit mitsamt der schlechten Unendlichkcit ihrer geraden Linie zur Para bel aus Gestalten, zum offenen System und den besetzten oder (wenn das Genie neu wie ein metaphysischer Einbruch ist) zu den projekriertcn Feldern in diesem pcriodischcn System von Formcn, besser: Siegelkategorien der Musik iibergehen zu wollen.
Es gibt hier ein deutliches Meinen, und dieses auch trennt ab, ordnet rein hinzu. Fiir das, was sidi darin gestaltet, fuhre ich den von Lukacs zuerst gcbrauchten Hilfsbegriff des Teppichs, als der reinen korrektivhaften Form, und der Wirklichkeit als der erfiillten, auftreffenden, konstitutiven Form ein, So lassen sich, halb verdeutlichend, halb eingedenkend erganzt, je nadi dem Schwung der angewandten KraA: drei Schemen untersdiei .. den. Das Erste ist das Endlose vor sich Hinsingen, der Tanz und schlieiilich die Kammermusik, diese aus Hoherem herabgesunken, zumeist unecht teppichhaA: geworden. Das Zweitt nimrnt cinen groEeren Anlauf: es ist das geschlossene Lied, Mozart oder die Spieloper, weltlich klein bewegt, das Oratorium, Bam oder die Passionen, geistlich klein bewegt, und zuoberst die Fuge, die Freilich hinsichtlich ihrer unendlichen Melodie schon in die Ereignisforrn iibergeht, von der sie aber andererseits durch ihren rein archirekronischcn, undramatischen Kontrapunkt entscheidend getrennt ist. Hier wohnen so durchgehends die Gebilde der geschlossenen oder wenigstcns ungestort erbliihenden, einthcmatischen Melodie. Dieses Zweite ist nicht
22
ehr von obenlier ins Cegenstandslose herabgesunken, sondern m hat seinen Gegenstand in einer gewissermaBen [eichteren, ~:imter erreimbaren, tiefer gelegenen Region des Ich, jedoch
ur so daE es jeder gewaltigeren Bewegung, also der entspre~end;n Ereignisform gegeniiber, wie ein Vors?ie~, w!e ein a.llerdin"s echter Teppich, wie reine Form und wre em Korrektiv ersmei~lt, das nun mit seiner schonen, srillstehenden, das .hei~t rein lyrisch bewegten und sonst nur zusammengefiigten Einheit in das Dritte, in die Ereignisjorm, in den Aufruhr der schweren, maotischcren, dynamism symbolischen Symphonie hinein[euchten soil. Dus Driite ist das offene Lied, die Handlungsoper, Wagner oder die transzendente Oper, das grolie Chorwerk und Beethoven-Bruckner oder die Symphonie als die losgebromenen, wel tlich, wenn auch nom nicht geistlich grolsen, durchaus drarnatisch bewegten, durchaus transzendental gegenstandlichen Ereignisformen, wie sie alles unecht und edit Tcppichhaflc rczipicrcn und im Hinziehen auf das Tempo, auf das Brausen und Leuchten in den oberen Regionen des Ich erfiillen. Es liegr nahe, hier an den dreifachen, syllogistischen Aufbau der form in den anderen Kunsten zu denken, Das Stilleben, das Portrat und die groBe LandschaA:; das lineare Ornament, die Plasrik und das mehrdimensionalc Ornament der eidetischcn Figurenkomposition und Architektur; die Novelle, die Lyrik und daruber die groBe Epik und Dramatik; ja, wenn man den Syllogismus der blofsen Komposition nom weiter ziehen will, auch die cigcntumliche religiose Formenfolge der schwarrnerischen Wundersudn, des Protesta ntismus und des gebauten, vcrrnitrelten Kirchcnglaubens - aile dicsc abstrakten AnLinge, individuellen Mitten und konkreten Erfiillungen der Abstraktheit gehorchcn einem Rhythmus, der dem der rnusikalischen Formen ahnlich ist, und einem verwandten Syllogismus: vorn behaglich schonen Spiel, als die Stufe des Gemiits, zur vollen, in sich wandelnden Individualitat, als die Stufe der Warme und der Seele, bis zur lcuchtenden Harte des Systems als die Stufe der Macht, der Tiefe und des Geistes. Was noch zentraler vor sieh geht, und darin allerdings das bloB f?rmelle Spiel der dialektischen Anordnung sprengt, das ist erne hier nur erst anzudeutende Beziehung des griechischen Mozart, des gotischen Bam, des barocken Beethoven und Wag-
23
ner und des unbekannten seraphischen Musikers zu den entsprechenden Standindexen einer Geschichtsphilosophie der erbauten Innerlichkeit in der Welt.
Die Fiille und ibr Schema
Wie also horren wir uns zuerst?
Ais endloses vor sich Hinsingen und im Tanz.
Diese beiden, sagten wir, sind noch namenlos. Sie leben nicht an sich, und niemand hat hier personlich geformt. Sie besitzen, wo man sie vorfinder, den Reiz des urspriinglichen Anfangens. Doch erst mulire man eben durch Anderes hindurch, das diese ursprlingliche Tonweise aus ihrem bl06 Unmitrelbaren bewu6t herausbrachte. Das gar den Ausdruck breit und fest sich zuriisten lief]. Darin freilich konnen wir Schrei und Tanz wiedersehen, wo sich cin Kiinstlcr auf sie besinnt.
Es sind Riickstande oder Hoffnungen, gleichviel. Sie mdgen hier noch liegen bleiben, rnitsamt der Kammermusik, die halb abgcstandensre Obungsform sein kann, halb fruchtbarsre kontrapunktische Feinheir und Errctten der Son ate vor ihrcm allzu schludrigen, allzu schmi6hafl:en Dahinstiirzen. So wird auch noch riickwirkend zu erkcnnen sein, wcldie Bedeutung bei Bach und Wagner das endlose vor sich Hinsingen und dann vor allem der Tanz erlangen.
II
Das Lied
Aber noch tragt sich hier alles gar still zu.
Man rundere bald daher sein Singen zierlich abo Solches klingt im Freien edit, aber bei Silcher wird es falsch. Es ist die totgeborene Art des falschen Volkslieds odcr Biirgerlieds. Das Gesungene ist frlih aus Schrei, Tanz und Zauberwcisen herausgetreten. Wenigstens scheinen bereits die Minnesanger aus redtt gedarnpfler Mitte heraus erfunden zu haben. Aber erstaunlidl ist, da6 selbst so spate Kiinstlcr wie Schumann, der frlihe Schubert, ja noch Brahms darin Bedeutendes gewirkt haben. Durdt
24
sie ist das geschlossene Lied als weiche, homophon melodiose form mit einfachstern Zeitmaf £xiert worden. Sie schwelgen, man fahrt auf diesen Liedern, sie klingen iibcrhaupt nicht anders aus als in Stimmungen, sie sind deutsch und dennoch widerspruchsvollerweise endlich, manierlich, wenn nicht gar strophenhafl: melodisch geschlossen. Es mag sein, da6 die stille und bald so schr verdorbene, so sehr liedertafelhafl gewordene Sangeslust des Biederrneier viel zu diesem Sieg des Biirgerlichen beigetragen hat, mi tten in einer Zeit, die zwar nicht bei Zeiter, wohl aber bei Schubert nach ganz anderen Zielen aussah. Klar ist die Arie, gar die leicht nachsingbare, wohlig geschlossene, wahrhaft volksmaBige und noch ungebrochen auf die Laute gestimmte italienische Cantilene. Sie lebt in der Oper, lebt davon, daB jedes Kabinettsstiick einen Anfang und ein Ende nirnmt, und hat insofern von Pergolese bis Offenbach ihre fertige, ebcnsowohl vom Sanger wie von der Oper aus wohlverstandliche, tcppichhafte Formung.
Zu Mozart
Mozart ist d2.S Haupt dieser glanzenden Reihe.
Er vermag leicht und beriickend zu singen, geschlossen zu singen. Darin weif er von sich, von uns, soweit wir darin erreichbar sind, ganz einzig zu sprechen. Bei ihm wird es anders still, die Nacht geht auf und holde Gestalten ziehen uns in ihre Reihen. Abcr auch, es ist noch nicht jene N acht, in der es sich verwandelt, in der das Licht ausloscht und die Bergfee erscheint, und ein Schimmcr wie Morgenrot, wenn die Sonne nicht mehr fern ist, iiberz.icht aile Wande. Vielrnehr, die Kerzen brenncn writer, alles bleibt von ihnen bcschienen, liebenswiirdiger, verklircnder als es dem Tageslicht gelingt, hie und da rokokohaft dem Driiben bcnachbart, aber sonst perlmuttern und nur von aulien her bcleuchtend. Der Gang solch bunter Tongestaltcn ist hochst schwebend, beflugelr, jedoch es gibt keinen TJ.umel und k eine Sprengung, nicht einma l in den bewegtercn Ensembleszenen des figaro, es gibt vor allem keine andere als die lediglich rezitativisch gemeinte und iiberreidite HJ.nd.lung, iibcrgehend, hindurchgehend und wieder iibergehend Ins LIed. Rasch stromt die Szene derart ein zur Arie, als der
25
sich sammelnden Empfindung, dem sich sammclnden Geflihl einer Situation, als der Dauer des Ausdrucks einer Empfindung, ohne Tendenz, brausend, gemeinsam das punktuelle Korperidi und seinen malivollen Raum zu verlassen. Ob zierlich, ob schmerzlich, ob heiter ist diese letzre edle Musik ruhig und plastisdi, so sehr, daB die reizvoll an- und absetzende, reinlich antwortende, sich in reinlichen Antwortcn verschlingende Melodie selbst zwischen dem heiteren Gastmahl und dem mystischen Untcrgang Don Juans keinen Untcrschied zu machen wiinschr, im Hinblick auf die gleichbleibende Gcschlossenheit und Plastik ihrer Linie urid Form. So auch blcibt fast alles an dicser malivoll genahrten Handlung, rnelancholisch lind gefaflten, gesammelten Arie silbern, porzellanhaft; selbst der aufgeregte, freie, klirrende Marsch verkleidet sich in Chinoiserie; und wie sich das Rezitativ teppichhaft genug versdilieiit, so geht auch die Zeichnung des inneren Lebcns, seiner allein rezitativisdi dargestell ten Handlungen und der Ergieliungen seiner lyrisch ausgeschopfren Fulle nicht so tief ins aufgewiihltere, wirklichere Ich, ins drama tisch ausbrechende oder gar mystisch erkannte Ich herein, daf die Mozartsche Oper den Kreis des Puppenspiels, der Spielopcr, Marchenoper, oberstenfalls des Teppichs zum musikalischen Gnadendrama verI ass en konnte. Gewif doch, es gibt Stollen, die man nicht vergilit: das Zwiegesprach mit dem Priester und der plotzlich einbrcchende Ernst der priestcr lichen a-moll-Melodic, oder der fugierte Satz und wie sich dariiber der steinerne cantus firmus der beiden geharnischten Manner vor dem Tempeltor gleich einem Tauf- und Pragesiegel aufgerichtet crhebt; diese beiden gewaltigen Tongestalten aus der Zauberfl5te sind ein zwcites Gesicht, sie zerreiilcn den Teppich gleich einer ungeheuren, starreriden, gorgonischen Vision, die sich ihrer erinnert tiber allem Spiclcr ischen, Spielmaliigen und f1acher Paradiesischen der sonstigen reinen Form. Aber audi dieses ist Kindheit und im Grunde unbewahrter Traum, es ist siebzehnjahrige Musik, hinter der sogleich das Sinken des Erwachsenseins droht, und die diese teppichhaft immanente Kunst an anderen Stell en nicht entscheidend wirklich machte, zum Ernstfall zwang.
Mozart bleibt derart das Haupt der Siidmusik, fast stets nodi unformbar in Sichtbarkeit und plastisches Entziicken. So wollte
26
er deun auch im groBeren Gang und Zug melodisch nidit gestort wer dcn, in dic Ferne gehen. Es wird verstandlidi, wie rasch sich hier selbst in dem breiten und armospharenhaflen Werk seiner Sonate die Scele zusammenfafit. Man erlebt diese Gebilde mit melodischem, oft, wie in der unvergleidilichen Ouvertiire zur Zaubcrflorc oder im Finale der jupirersymphonie mit kammermusikalischem, aber selten odcr niemals mit symphonischem Gewinn. Sie sind durchaus anmutig erfunden, oR: mit einem unerhort groBen Bogen edelster Intervalle, und ill allem Einzelnen so bliihcnd und reich, daB nur noch Schubert diesem melodischen Reichtum nahekommt: aber es ist nichts gcschehen, wenn das Therna wicder auftaucht, es ladet sich nichts und cntladcr sich nichts, es gibt keine verschnciten Wege, k cinen Nebel, keinen Wald, kein Verirrtsein und kein warrnes Licht in der Ferne, cs ist ein Iiebliches Sich-Ergehen und perl enarrig gercihtes Voruberziehen, und der Gegensatz zeugt weder Licht noch Warme, noch jene Musik des Durcheinander, die doch sonst in der opera buffa meisterlich beherrschte. So vieles ruht in dcr kleincn, untereinander bewegungslosen Stimmungsfolge des k leinen weltlichen Ich und der blollen, zeitlich wie raurnlich kurzen Dynamismen seiner Korperseele. Zur Sadie gehort daher, ohne aile Hcuchelei und mit Liebe zum Teppich: die Durchfiihrung will und kann hier keine Spannung und keincn Willen zur grofsen Linie halten, wie sie aus dem expansivcn, mit Notwendigkeit expansiven Feuer ihrer thematischen Gegcnsatze hervorgehen mtiBte. Das Ganze weist bei Mozart cinen arithmetischen Zug auf, der der bewegten Beethovenschen Symphonie als einer gewahlten, sich sichtbar und organisch zusammenfiigenden Bildung prinzipiell widerspridit. Diescs ist dassel be, was Wagner zu der richtigen Bemerkung veranblltc, daB sich bei Mozart die ernpfindlichste Grazie mit ciner erstaunlichen Begabung fur Arithrnetik verbunden hat, woraus sich eben der Wertcharakter dieses beriickenden, aber nicht erschiitterndcn, dieses weltlich klarenden, aber geistlich fast problemlosen Griechentums in der Musik ergibt.
Die Passionen
Man wiinsdite zwar auch dariiber hinaus nicht sogleich bewegt zu werden.
Die Sehnsucht war bci Bach kein hinausbrennendes Feuer, sondern in sich bleibende seelische Tiefe.
Derart eben war ihr nicht wiinschenswerr, sich sogleich bewegt und offen zu geben. Auch bei Bach geschieht das Erzahlen uberwiegcnd gleichbleibend rczitativisch. Erst dort, wo die Stirn me gleichsam erstickt und vor Tranen nicht we iter kann in dem sich Vorerzahlcn der heiligen Ereignisse, werden die erregteren Tone lyrischer Einkehr frei. Diese lyrischen Gebilde werden jedoch, ohne ihren gewufsren Ort zu verlassen, ihrer ebenso tief versunkenen, oder gar, wie es bei Keiser und der gleichzeitigen Hamburger Schulc iiblich war, ins Opernhafte auszuschweifen, durchgehends unter die Herrschaft des Chorals gestellt. Irn Choral also kehrt das Bewegte wieder in einen geschlossenen lyrischen, rnithin undramatischen Zusammenhang zuriick, Freilich mit dem letztcn Zweck, bereits zu diesem, als dem auch iiberdrarnatischen, hiniiberzuschlagen. Denn wenn Jesus sagt: -Einer unter euch wird mich verraten«, und die JUnger im heftigsten Allegro aufgeregt durcheinander schreien: »Herr, bin ich's?«, und nun nach einer wunderbaren Pause die Gemeinde den Choral singr: »Ich bin's, ich sollte biiBen«, so hallt das Innerste in diesem Augenblick der Matthauspassion wieder, und Kierkegaard selber konnre fUr dies ad hominem Gesprochenwerden, fiir das christliche Tun und Subjektivieren des Christlichen keine gewaltigere Predigt finden. Derart also ubersdilagt das lyrische Gestimmtsein des Chorals sowohl die bloB private lyrik der Personen wie auch die sogleich zu besprechende auBere Dramatik der eigentlichen Chore. Denn gleich einigen der Betrachtung geweihten Arien ist der Choral wesentlich die Ausdrucksform einer oberen oder Zionsgemeinde, wie sie gleichsam jenseits des Geschehens wohnt und in dem iiberschlagenden Teppich ihres nicht mehr privaten oder, was ja an sich unmoglich ist, bewegten, prozessualen, dramatischen, sondern wahrhaft iiberdramatischen, ontologiscben lyrismus jener oberst en Biihne entspricht, die die mittel alter lichen Mysterien iiber der Erde und der Holle als Himmel aufgebaut
28
hatten. Ganz anders stellen sich allerdings jene eigentlichen Chore dar, in dencn nun, wie der kraftige epische Handel, so auch Bach nicht mehr in der homophonen Gestalt des alten c\'angelischen Chorals, sondcrn wild, zackig und mit aufgeteiltern Rhythmus kontrapunktiert, Hier wird zumindesten gehandelt, und wir sehen durchaus in eine leidenschaftliche Bewebung hinein. So bei dem »Kreuzige!«, bei dem wiitend herausbestoBenen Verlangen nach Barabbas, bei dem rasenden Chor:
"Sind Blitze, sind Donner in Wolken verschwunden«, iiberhaupt bei allen Juden- und irdischen Gemcindechoren, in denen die Menge fordert oder anklagt, urn derart ganz anders als das erz;ihlende Rezitativ in die Handlung einzugreifen, ja eine lcidcnschaftlichere als die biblische Handlung selbst zu erzeuben. Damit wird jedoch zugleich ebenso das Wort verlassen wie der srille und gesdilossene Formtyp im engeren Sinn endlich gesprengt. Die menschliche Stirnme kann sich im Chor nur noch als musikalisches Instrument verwenden lassen, wie ja auch die ausgebildetere Vokalmusik von selbst danach drangte, ihr Bewegtwerden auf das zugleich reichere wie fesrere Kolorit der Instrumente zu iibertragen, ja sich dorthin aufzulosen oder wcnigstens nur noch als der oberste, ausdrucksmachtigste Teil des Orchesters zu figurieren. Es war mithin die selbstverstandliche Folge, als Bach den alten Vokalismus auf die Orgel und das Orchester iibertrug, daB hier wirklich die »Stimrnen«, die schon vorher im verwickelten chorischen Gebrauch alles spezifisch lyrische verloren hatten, unter den Rhythmus eines neucn, aus ihrer Vereinigung und kontrapunktischen Entwick'nng resultierenden Stils gebeugt wurden. Und dieser muiite :d, melodische, oder besser gesagt, melismatische Erfindung unrcr erschwerten Bedingungen das ungestorte, geschlossene, vordcm nur begleitete, wenn auch mehr oder minder durchbrochen hegleitete Solo der Melodie erheblich schwachen, wonach sich d('11n bci Bach die Fuge, und bald nach Bach das Ungeahnte, die Son ate zu Beethoven hin, aus dem Zerbrechen der geschlosse»en Melodic ergeben hat.
29
Bach, seine Form und sein Gegenstand
Das Lied also wird wcit, unendlich, aber gleichsam intern unendlich in der Fuge.
Hier ist alles durchaus sangvoll zu spielen und deurlich durchbrochen. Aber ist Bach deshalb rein ronleiterisch anzusehen, mit Scheu vor der klanglichen Mischung liberhaupt? Es ist freilich dieses, was dem obcrflachlichen, schulbeflissenen Kopf am leichtesten zuganglich ist. Darum gibt es auch keinen besseren Vikar, der sich niche als Bachtrompete fuhlte und nicht bemiiht ware, die unbegreiflich hohen Werke zur rechten Kiistermusik zu verwandeln. Man hat aber mit Recht gesagt, dag der spitze kurze Ton des Kielfliigels keine einzige der Badischen Voraussetzungen erfiillte. Desgleichen auch ist es keineswegs irn ganzen Umfang wahr, dag fur Bach immer nur die Orgel, die Stirnmenorgel, die Orchesterorgel das entsprechende Klangbild bedeutet hatte. Und es untcrlicgt keinem Zweifel, daB uns erst unsere Fliigel, die unvergleichlichen, fiir den neuen Bach geborenen Sreinway-Fliigel, die klaren, drohnenden, silbernen an der Spitze, darauf gebracht haben, wie der Meister neu zu spielen sei, was man von den vielen Verzierungen, aber auch, was man von der scheinbar unentwegren Stirnmigkeit halten miisse, und wohin, zu welcher sangvoIIen, also nichr einfach harrnonischen, aber auch nicht der Harmonie fremden Blute das wohltemperierte Klavier aufzugehen habe. Bach hat sowohl das endlose Singen wie den alten, rhythmisch vielfach geteilten Tanz aufgegriffen; der friiheste Teppich beginnt damit eingeholt zu werden. Was dem Meister des inneren Auflebens aber am Herzen liegt, ist der thematische Keirn dieses singenden Geteiltseins; er liebt sein Thema, in dem er wie keiner sonst das Kommende, Spannung und scharfstcn Urnrif der Spannung, verdichret hat, und er sieht das Thema mit dieser Liebe so lange von allen Seiten und Hoffnungen her an, bis es aufbliiht und in den groBen Abwandlungen der Fuge zu einem aufgeschlossenen Schrein, zu einer intern, das heiBt eben vorn Lebenskreis des Themas begrenzten, zu einer intern unendlichen Melodie geworden ist, zu einem melismatischen Universum hinsichtlich der cntwickelten Individualitat seines Themas. Deshalb gerade ist Bach nicht rein tonleiterisch angelegt, so deut-
30
heh auch alles durchbrochen ist. Sclbstverstandlich wird bei Iheh das Harmonische an sich gleichgiiltig, sofern es als zufillige, angenehm bedeutende Gleichzeitigkeit der Stimmen erscheint. Aber doch nichr in dern Sinne gleichgiiltig, dag die Bewcgungen dazu und ihr Ganzes, also eben der Kontrapunkt, nun auch das Oberragende und schlechthin Pointierte ware. Er ist, sofern er die vollige horizontale Durchsichtigkeit bedcutct, ~ewiB das Bachische Wesen sicherer als er Beethovens und \\'agners Wesen ist. Und doch gibt es im Auseinanderlegen auch bei Bach ein Wollen und die hindurchstrornende, beziehungsreiche Flut eines thematischen Nacheinander, einer zweifachen, unter sich schon spannungsreichen Thematik, die sich auf die Durchgangs-, Wende- und Eckpunkte, vor allem aber auf die rhythmisch betonten Haltepunkte der Harmonie - wie man sicht, keiner einfaltigen, homophonen, sondern einer andcren, erwahltcn, unterstreichenden, mit ihrer Masse pointiercnden Harmonie, - wei taus kraftiger angewiesen sieht als auf die entscheidungslose Stimmigkeit der bestandigen Polyphonic. Und dieses scheint in das andere herein, auch wenn Bach der Meister der einen Stimme bleibt, der Verdoppler oder VerIiinffacher der alten Einstimmigkeit, der innere Meister der Linicnverspinnung und ihres scheinbar unlyrischen, iiberlyrischen Raums. Das Verschmelzende, Harmonisch- Rhythmische hat dennoch seinen Einfluf und verhindert das Schwelgen im kontrapunktisch Apparatlichen und Formalen auch dort bei Bach, wo die weite Entfernung der Stirnmen voneinander wesentlich dazu beitragt, die vertikale Verschmelzung, also das Dascin und den Wandel von ganzen, wie imrner rhythmisch vcrk leincrten oder dominanthafl verschlungenen und wieder losgelosten Tonsaulen, Akkordmachten zu verhindern. Dadurch aber vor all ern, daB nichts als das Lied, das Thema weit, unendlich werden will innerhalb der gleichsam intern unendlichen \.fclodie der Fuge, sinh gerade das tonleiterisch Kontrapunknsche zurn blofsen Mittel herab, zu einem Reflexiven, das nur deshalb zugelassen wird, weil sich die immerdar sangvoll aufbliihendcn Melismen am Nebeneinander scharfer profilieren, lI~d wei I sic ihr bewahrtes, unzerrissenes Zugleichdasein, ihre nidus Einzelnes mehr betreffende, sondern einfach Seele entwickelts Seele bedeutende Lyrik - das trotz aller drarnatischen
Gemeindechore Zentrale der Bachschen Kirchenmusik - am besten im kontrapunktischen, odcr besser gesagt: dialinearischen Gleichgewichtssystem darstellen konnen. Wo sich dieses Gleichgewicht verselbstandigt, ist es ein Leichtes, gleichwie sich in der unebenen Flache des Reliefgrundes Luft, Anordnung der Figuren in der Landschaft, ja die ganze, im Auf und Ab des unebenen Grundes untergegangene Landschaft selbst verspiiren lalk so auch im Gefiige des Bachischen Kontrapunkts die untergegangene, zusarnmengebaute, iibereinandergebaute, in die Nischen der dreidimensionalen Kontrapunktik eingebaute Lyrik der Passion en zu erkennen.
Wie es sich also von hier aus ergeben will, ist auch die lebendig, melismatisch gespielte Fuge ein Teppich oder ein Korrektiv. Sie Jalh sich als der Teppich vor allen Wirrungen der aufgeregten, chaotischen, melodisch gestorten Symphonie, mithin als der zugleich mit der Spieloper und den Choralen der Zionsgemeinde geltende Teppich der Vollendung, der KorrektivVollendung bezeichnen. Es scheint hier jedoch angemessen, urn nicht, unserem Grundsatz entgegen, zum Ubergleiten gezwungen zu werden, bei zweierlei Halt zu machen und zweierlei bei Bach als prototypisch zu betonen: zuniichst die innere Seele (nur mit dem Unterschied, da~ sich jetzt, in den Klavier-, Orgel- und Orchesterwerken, die Gestalt wie die Grenze dieser Lyrik durch die Anlehnung an das wesentlich architektonisdi kontrapunktische Gebirge deutlicher macht als in den Passionen); und sodann den Raum dieses Lyrischen, also die Mischung und das Gleichgewicht des Lyrischen und Gestalteten in einer wesentlich architektoniscben, gotisch architektonischen Harmonie und Kontrapunktik, die das cigene Haus, das gewisserrnafsen raumlich konstitutive System dieser Lyrik darzustellen gibt. Danach also darf sehr wohl von einer auftreflcnden Beziehung innerhalb dicses Kreises gesprochen werden, wenn auch die lyrische Geschlossenheit, in der sich, in die sich lctzthin bei Bach das Ganze seines Zusammenklangs, seiner Symphonie aufbaut oder einbaut, den konstitutiven Gegenstand dieses Kreises deutlich zum leichter vollendbaren Teppich oder Korrektiv eines Schwierigeren, Wirklicheren, Absoluteren cinschrankt,
Es ist bei Mozart das weltliehe, bei Bach das geistliehe lch, das
gegcnstandlich wird. Wie Mozart auf ein~ bewegte Art,.leicht, frci, besehwingt, gelosr und glanzend die Gefiihle khng~nd macht, so zeigt Bach auf eine gem essen ere Art, schwer, emdrin"lich gebunden, hart rhythmisierend, glanzlos tief das Ich
b ,
und sein ernotionales Inventar. Es ist mithin bei Mozart das (nod1 klcine) weltlich luziferische, bei Bach das (ebenfalls noch k lcinc) geistlich christliche Ich, das durch die sich nahere, subjcktivere, protestantische Gesinnung erreichbare Ich der Giite oclcr des gclostcn Adams, mithin noch nicht das hinter einer gam anderen Dynamik verborgene Ich des Blicks der Versammlung, der Glorie oder des gelosten Luzifer. Es ist das von inncn her crleuchtete Gehause des christlichen Tunwollens, in dcm Sinn, da~ die Bachsche Musik das Ringen urn das Heil der Scelc zum Ausdruck hat, die Stufe der Liebe und der HofflIung, hinter der sich - Bach parallel, ihm aber unzuganglich - die drci oberen Lebendigkeiten: die Stufen des Glaubens, der Erlcuchtung und der Apokalypse, innerhalb einer nicht erhabcncrcn, aber schwierigeren und endgiiltigeren religiosen Phanornenologie erheben.
III
Wozu abcr horen wir uns zuletzt? Nun, bald wird uns Freier zum ute. Denn der Ton will sich auch zum Handeln drangen. Er sitz t lockerer, spannt und ladet. Das Dritte, sich vdllig Hina uswagende kommt herauf. Das [riihe Kloster brichr, die wirre Welt, der externe Traum vor dem echten Kloster scheint herein.
Carmen
So ziehen wir nun leichter dahin. Das hei~t noch nicht, daf die einzclllen Gcsange strichlos, abschnittslos in die Ferne schweifen. Nehmen wir etwa Carmen, so sind die jeweiligen wilden, hUlltCll Lieder noeh gesehlossen. Aber ist es fur diese bezeich'lend, da~ sie nichr einfach nur aneinander gereiht sind, sondcrn sieh, ohne gebrochen zu scin, insoweit wenigstens geoffnet lind bcreit zum Zuge zeigen, als sie dem Gang der Handlung, scm ihn Iyrisch auszuzieren und aufzuhalten, blitz schnell zu foigen irnstande sind. Derart geht der Ton ins Weite, urn nicht
33
•
nur dern schwarrnenden, spielenden Menschen, sondern auch dcm jahen, treibenden, Platz zu geben, wie er sich im raschen Abenteuer vcrlicrt und bewahrt, Freilich noeh nicht eigentlich »findet«, Man braucht sieh hier nur an die vorbildliche Veranderung zu erinnern, die das wechselnde Tempo des Carmenmotivs in dessen Ausdruck hervorbringt. Auch wic Escamillo und Don Jose vor und nach dem Zweikampf zu einander singen, gibt in seiner gluhcnd wechselnden Folge, die sich wegen der einfachen Melodien trotzdern in runden, kurz kupiert gerundeten Forrncn abzielen kann, ein gutes Beispiel bewegt geschlossener Einfalle.
Offenes Lied und Fidelio
Anders steht es Freilich mit dcrn offenen Lied. Es ist vom letzten Schubert ab vor allern begonnen. Nichts bleibt herkornrnlich, an die Strophe gcbunden, die unteren Stimrnen sind reich gelost, schmiegsam und zu jeder Untermalung bercit, die Gesangslinie ist ausdrucksvoll sinngcmafs, und der Fluf der Steigerung wird zur wesentliehen Art des Ganzen. Das gilt vor allem fur Hugo Wolf, weniger fur Straufs, der liberal! dort, wo er mit weiehen Tonen riihren will, seicht, biedermeierlich und trivial geworden ist, aber dort, wo es gilt, herb zu schreiben und gliihende, ernste, gro~ geschwungene Texte, Klopstock und ahnliches, zu vertonen, wird Strau~ so gar zum gro~eren Meister. Aber auch, wo es zu handcln gilt, rettet das offene Lied. Besondcrs nachdem es steigend begann, reich durchbrochen, voll gefiillter Sorgfalt zu worden. Der Ton war rezitacivisch zu Iarblos, und er war zu langatmig im Lyrischen. Jetzt gehen die klingenden Ausrufe mit und verwandeln den Gesang zu einem kiirzer gehaltenen melodischen Geschehenen, das wechselnd genug ist, urn auch die Empfindungen und Ausbriidie handclnder Pcrsonen, das ganze Geladensein der Luft mit Raschheit, Schicksal, Entscheidung wiedergeben zu konnen. Darurn wird es iiberall dort, wo sich die Person in die Handlung, und diese wiederum in die Person crnsthafier einmischt, notwendig, die gesangvolle Form entschiedener zu brechen und aufzulassen. So bei Weber und mchr noeh bei dem hodisr bedcutsamen Marschner des Hans HeiIing, mit der herr lichen
34
Arie und dem einzigartigen Melodram, vor allem aber beim Becthonnschen Fidelio und dem Ratsel seiner Melodic. Das hat sich freilich allrnahlich so sehr verbreitet und ist so das Mittel geworden, Kleines aufzudonnern und statt melodisch geschlossener Einfal!e melismatisch zusammcngeriihrten Ersatz zu bieten, da~ es iiberhaupt keine Spieloper mehr gibt, sondern alles auf ein Gebiet heriibergezogcn wird, das nur fur die hefrieste Leidenschaft und Handlung reserviert bleiben sollte, Denn hier allcin ist diese Bewcgung erlaubt; formell immcr noeh Handlungsoper, aber cine, die sich aufs Kochen versteht, dabei von dem Carmentypus deutlich durch den symphonischcn Charakter unterschieden. Selbst der Hollander, Tannh.iuser, Lohengrin und vor allem die Meistersinger, die iiberdies einen vollkomrnenen Opernaufbau wahren, sowie grofse Tcilc des Rings zahlcn zu den Handlungsopern, als wclche die dramatische zum wesentlichen Ziel haben. Wie abcr bei Beethoven alles Gesangvolle iiberhaupt gleichsam trachtig wird mit cincr cndlosen, ausbrechenden Bewegung, so blcibt auch im Fidelio, als dem apriorischen Muster der symphonisch dramatisJlcn Gattung, kcin einziges Lied und erst recht nicht das Toben der Enscmbleszcncn in dem Festen Raum der wie immer bewcgtcn Melodic beschlossen. Der ausschweifend gehandhabte Ton, das Gewoge der Tone und der andauernde Zuschuf aus Spannung, Chaos und Schicksal schaurnt zu einer iiberwiegcnd unmclodisehen, rezitativisch melismatischen, motivisch thernatischcn, und sich im ganzen rein syrnphonisch entwickelnden Musik a r t iiber, die - von seIber schon jedem iiberlegten Text zurn Sport - nicht nur der Handlung Folgt, sondern selbcr Hnndlung, noch unbestimmte, namenlose Handlung crzeugt, in ch nun die biihncnsinnliche Anwendung und textliche »Begriindung« einzusetzcn ist.
Missa solemn is
Dels alles stcigert sich noch in dem Becthovenschen Chorgebranch. Gemcinsam zu singen, das war Fruher das Bediirfnis, sic!' gcmcinsam zu bekenncn. Es waren einsame Stirnmen, die im Dunkeln riefen, die sich antworteten und so zum Einklang im tieferen Sinn gelangtcn, Wir sahcn freilich, wie sieh die
35
menschliche Stirnme chorisch nur mehr instrumental verwenden laBt, aber wir stell ten zugleich fest, daf sie auch dann immer noch als der oberste, ausdrucksrnachtigste Teil des Orchesters gerettet bleibt. Das vordem so wichtige Wort Tritt dabei zuriick; es wird zum Netz und Stramin, in das die Tone hineingestickt werden, und das in deren Verschlingungen durchaus nicht mehr angedeutet oder nachgezeichnet werden kann. Gewif hindern die vier, auBerstenfalls acht Stimmen eine allzu groiie Beweglichkeit, aber es sind menschliche Stimm~n, die nicht nur verstehen, vor allern seit Beethoven, aile Steigerungen mit dem furchtbarsten Ernst herauszuarb.eite~, sonde:n ~ie erst recht dort, wo es auf Wucht, Ruhe, Geistigkeit, Geheimnis, also auf die Hohepunkte und das Fazit des dramatisch symphonischen Stils ankommt, den vollen iiberdramatischen Ratsel-. schimmer des Rufens, wenn nicht schon der Erhorung einer anbetenden Gemeinschaft auszubreiten in der Lage sind. Nun, die alte Gemeinde ist zersprungen, und wir konnen den Chor, ihr Werk, nichr mehr als daseiende, sondern nur mehr als ersehnte Glaubensmacht und Glaubenseinheit genielien oder gar schaff en. Es ist ein anderes sich Versarnmeln gekommen, ein anderes Suchen und Finden der darin fest zusammenstehenden Seelen eine andere Sehnsucht nach Organisation und vor allem n;ch dem Gehalt eincr Organisation, einer Erdballsbreite, die die Menschen zusammenfiihrt, die ihnen im Chorwerk tausend Stirnmen schenkt, urn nach dem Einen zu verlangen, urn nach oben hin von dem Wachen zu verkiinden, um mit einem tausendfaltigen, musikalisch trans zen dent gewordenen Schrei Rettcndes zu berufen. Dazu ist der Chor ein Mittel, er bietet sich dazu dar, stiirmisch und kathedralisch, mit der steigenden Linie der neuen Glaubigkeit, die sich von der Bachschen hmoll-Messe zum "pater ornnipotens« der Missa solemnis und zuletzt zur Brucknerschen Kirchenmusik, vor allem zu dessen f-moll-Messc, in irnmer leidenschaftlicherem Barock hinzieht. Zu immer entschiedenerem und nicht rninder philosophisch zu verfolgendern Bewufitsein, daf die Gemeinde den heiligen Geist weniger zu preisen als zu bekennen hat.
Die Geburt der Sonate
x r: les andere hat sich schon gezeigt, das neues Leben bringt.
Y ie k ch sei ,
NUll rragt das bewegte opernhafte ~en e~ au sel~e elgen~te
Frucht, die Sonate herbei. Man welB, wie entscheidend sich kurz nach Bach die Schreibweise geandert hat. Er seIber stand 'a wic ein fremdartiger, waldmalliger Riese mitten unter den ~alantcn Mcistern. Lei0t und k.raftig .hatte sich s(~l0~ lange die individuell konzertierende Einzelstimme der Violine und des Gesangs erhoben. Nicht mehr gebeugt unter Stimmigkeit, frei ausschwcif end, immer ferner dem standischen Gliedbau des mittelalterlichen a-capella-Stils, Bereits Bachs Sohn Emanu~1 half die neue Spielwcise, den Ausbruch der homophonen Individualitiit, zu begriinden ; und Haydn ist dessen groBerer Nadifolger im Sonatensatz, wie er in Scarlattis dreisatzigern Opernvorspiel sein bezeichnendes Vorbild hat. Hi~r lauft .der Gesang, in vollig beweglich gewordenem Satz, semen Ireien, die ganze Sonate beherrschenden Gang, Die anderen Stim.m~n sind dazu da, die Melodie von allen Sciten zu umgeben, sie In sieh unterzutauchen und scheinbar auflosen zu lassen, urn dann desto bcrcitwilliger wieder in den untergeordneten, blofs ausschrniickenden, durchfiihrenden Stand zuriickzutrctcn. Es gibt also nidit mehr ausschlieBlich durchgefiihrte Stimmen, sondern Haydn verwcndet Fullstimmen und besonders Gruppen von Instrumenten, die beliebige Massenwirkung und ein beliebiges harmonisches Kolorit ermoglichen. So wird, schon auBerlich angesehen, das Thema gleichgiiltiger; es will die Entwicklung nicht mehr erzeugen, sondern umgekehrt durch die Entwicklung z u irnrncr groBerem Leben und Glanz erzogen werden, - ein leiehteres Gewebe mit der bei der Fuge ganz unrnoglichen Ungcduld im Einschlag, derart, daB man mit Recht gesagt hat, ein schlechter Takt verderbe die Fuge, aber ein einziger guter Takt rette die Senate. Trotzdem gibt es hier kein Zuriick, nadidcrn dcr freie Eintritt der Stimme endlich zum Ereignis geworden ist, und es geht nicht an, nach so vie! teuer erkauftem POSitiven die neuen, leider am Ende sehr »poetisch- gewordenen Blatter zuriickzuschlagen oder auch nur zu iiberschlagen, urn wieder die bedachtig, schwunglos gute Satzarbeir der Fuge Takr fiir Takt zu gewinnen. Hier bleibt es so, durchaus so,
37
auch flir den, der das neue Uberrurnpeltwerden nicht liebt, daB man nach dem Dasein der Eroica seine Marschroute, den Befehl des veritablen Zeit-Geistes zu dieser Marschroute erhalten hat. Wobei es iibrigens auch dern sorgfaltigeren Geschmack ein Leichtes werden mag, sich Beethovens Senate, die ja ebenso voll von demagogischen Mitteln wie von VerheiBungen, von wahrhaften Hohepunkten und weithinschwingenden Domi-' nantspannungcn ist, anders, aber so stark wie der Bachschen Fuge, bis ans Ende hinzugeben. Was uns daran so sehr erschiittert ; die blitzartig wechselnden Tonstarken, das Wunder der Horner, dieser bliihenden, sattigenden, hallenden, dem Pedal vergleichbaren Fiillungen des Klangs, bitterc Kalte - ablosende Wache und Nachterzahlungen - Glaube und Unglaube - der Stern - und nun erscheint's, das Gespenst oder der Geist, mit allen Mitteln des Schlagzeugs, der Posaunen, der Orgel und des vollen, irn auBersten Fortissimo ausgehaltenen Orchesters: es ist eine neue Daseinsweise des instrumental en und dynamischen Ausdrucks, die gleichsam aus der Farbe und Beleuchtung heraus die neue Zeichnung erfinden, harmonisch dramatisch erfinden laBt und derart Windessausen, venezianische Glut in das zuerst so diinne und volumenarme Wesen des thematischen Wandels hereintreibt. Freilich benutzt Haydn nur erst insofern das reiBende Nacheinander der Farbe, als hier nicht mehr cinfach gesungen wird, sondern im oberen, von unten her so vielfach melismatisch durchbrochenen Gesang Kampf geschieht, als mithin eine zweite Melodie, ein Gegensatz und der Durchfiihrungs- wie Vereinigungsreiz dieses Gegensatzes hinzukommen. Das scheint wenig, zumal da die zweithematische Form von Haydn nicht eigcntlich erfunden wurde. Auch Bach laBt bereits deutlich, vor allem in den Einleitungssatzen seiner Partiten, das in einem zweiten Thema ausgedriickte Prinzip des Gegensatzes als Urbild der Sonatenform erkennen. Aber was hier geschlossen auftauchte, wird von Haydn imrnerwahrend behauptet und einer formlichen satztechnischen Weltanschauung von Polythematik zugrunde gelegt, die unrnirrelbar zu der Abentcucrwelr des gelockerten, dramatisch symphonischen Stils der absoluten, der Beethovenschen Son ate pradestinierte,
Brahms und die Kammermusik
Falsch wurden darin solche, die zu sauseln liebten und zugleich car billig darin klar wurden. Nochmals auch tauchten die zilch~lgcn Liedersanger hier auf, wurden »symphonisch« und olten die begonnene Woge. Nur einer fallt heraus, suchte Beethovens wahre Spur: der letzte Schubert, der seine homophone Liedwrgangenheit haBte, und der fast genau in dem Augenblick starb, als cr seine eigentliche Begabung begriff, das Schwelgen in Langen und den Aufbau zugleich, wie sie ihm seinen Platz bci Bruckner an weist. Aber die anderen, so verschieden sie auch untcr sich sein rnogen als »Syrnphoniker«: der armselige Mendelssohn, immerdar heiter und gewandt, Schumann, dieser unghickliche Mochregern, Chopin, der brillant gewordene Klavierist des ancien regime, und der mannliche, unvergleichlich vicl groBartigere Brahms, ein Riese dagegen, - so einheitlich ist ihnen doch jener fatal sittige und gemaSigte Zug, der nur Chopin hier und da freilaBt, so in seiner hcchst interessanten, Wagner verwandten Chromatik, urn ihn daflir an anderen Orten in den leeren Gegensatz des Salonglanzes, edler, aber zumcist nichtssagender Fioriturenkunst einzustellen. Ein Zug, der Brahms, den heiBen, dunk len. tiefen Brahms, immer wieder 7.U111 Sprecher und Parteihaupt einer ziichtigen mitteldcutschen Bourgeoisie miBverstehen lieB. Also kamen die Rechtschaffen en, bis vor kurzem Fortgezeugt in den musikalischen Bildungsa nst alren , als eine unwiirdige, wenn auch nicht ganz unverdir-ntc Nachfolge des bosartigen Durchschnitts hinter seinem Br.ihms. Damals war die Musik ernsthafl in Gefahr, aus einer Wcltsache zur akademischen Angelegenheit der deutschcn Biirgcrstube, der Bildungsschicht mit all ihren Hemmungen und ihrcr fruchtlosen Sentimentalitat zu werden. Aber es ist sehr 7.\1 beklagen, daB sich gerade Brahms so kanapeehaft in die Scheu vor all em Feuer zurUckzog. Er hat Farbc, wie man denn auch sein Klangbild nicht libel mit der norddeutschen Heide verglichen hat, die aus der Ferne wie eine weite, eintonige flJrhc erscheint, aber wir treten in sie hinein, und mit einern ~blc lost sich das Grau in ein Vielerlei von kleinen Bliiten und Farbigkeiren auf. Freilich will Brahms nicht mal en oder Stimmungsmusik schreiben, sondern er will und kann den me-
39
lismatischen Gehalt zusarnrnendrangen mit der Lust am organischen Bilden, mit den sorgfaltigercn alten polyphonischen Mitteln und der organisch plastischen Gliederung als Ziel, erschwert durch cin dichtes Kreuz- und Quergeflecht tonleiterticher Linien. Jedoch es geht nicht an, noch so hoch im Gedanken drin die Disposition zu spannen und dort in Plastik zu schwelgen, wo doch selbst das gut Geformtsein unwichtiger wird als das rhythmisch emotionale gut Gestelltsein, Nichts kann darum uneigentlicher und Beethoven gegeniiber einc schlechtere Nachfolge scin, als so, wie es dem Brahmsschen Konservatoriumstrieb entspricht, den Meister, den Weltgeist der Musik, der die Klaviere zertriimrnert, bei dem es Miihlsteine regnet, und der das starkste Orchester noch zu einem schwachen Bcrtelkram vor der apriorischen Ubermafsigkeit seiner Partituren verwandelt, zur wohlerzogenen Klavier- und Karnmcrkunst zu verkleinern.
Wir haben diese deshalb schon vor allen Ernst als teppichhaft herausgesetzt. Man sieht daran, was einer kann oder gelernt hat, und die paar Stimmen bringen alles an den Tag. Vieles mag hier auilerdem schwankend sein und stark nach Ubergangen zum Wirklichen suchen. Es ist moglich, daE es einen eigenen vier-, fiinf- und sechsstimmigen Satz gibt, der nicht nach rnehr Stimmen verlangt, und der jene Selbstandigkeit fiir sich behauptet, die er anderen, deutlich ins Symphonische gleitenden Gebilden, wie etwa dem Oktett, seIber abspricht. Aber das alles ist nichts fiir sich und in sich, bevor es nicht die Verwendung seiner Sauberkcit und Durchsichtigkeit im groEeren Zusammenhang erfahrr. Es gibt keine guten Zuhorer, die dem Streichquartett eine eigene Seele in einem seine aufdringliche Geformtheit wie immer erleuchtendenAusdruck zubilligen wollen oder konnen, Wo es sich anders verhalt, wie in den letzten Beethovenschen Quartetten, ist es ein Kleines, das Licht nicht mehr davor, sondern dahinter zu stellen, wie es die ganze nach innen, nach riickwarts ausgedehnte, hintergriindige Struktur der grofsen Tongestaltung iiberhaupt verlangt. Man darf hier die bemalte Fensterscheibe nicht von vorn und bei Tag beleuchten, wobei sic Freilich vor den echten, den bildenden Formkiinsten iiberhaupt nicht bestehen kann, sondern Beethoven stellt nach dem ausgezeichneten Wagnerschen Gleichnis das rna-
40
gische Glasgcmalde in das Schweigen der Nacht, zwischen die Welt der Erscheinung und die tiefinnere, verschlossen leuchtende des Wesens aller Dinge, wodurch sich erst das verschlossene Bildnis belcbt und von einer Welt Kunde gibt, zu der nicht die angeordnete, sondern nur die gepragre Form, die lebend sich entwickelt, also die organisch eidetische Transparenz der Musik Zugang hat. Aber iiberall sonst bleibt nichts als das bite, schulmafiige Vergniigen an der Verflechtung der Themen, an ihrem Eintreten, Treffen, sich GriiEen, Abschwdchen, Stcigern, miteinander Gehen und Vereinigen, als ob und nicht cinrnal als ob sie wirkliche Menschen warcn, die sich begegnen und dadurch die Schicksale des Dramas anheben lassen. Wenn sie iiberhaupt bestehcn diirfcn, all dicse Freuden und Selbstbcst.itigungen des Kenners, der ja allzu oft schon snobistische oder pedantische Mittelstandspolitik getrieben hat, dann doch nur insofern, als sich die Kammermusik vollig auf den Ort der reinen Form zuruckzieht, des Reservoirs der Sauberkeit und melismatischen Schonheit des Einzelnen, des einfalIsreichen, bliihenden Solospiels alIer Instrumente, aus dem dann nach Beethoven Bruckners wahrhafte, sich ins Tatige, »Effektvolle«, Wirkliche hinauswagende Symphonic die Nahrung ihrer Einz.clhcircn gezogen hat. Insofern also ist, wie hier nachtragend spruchreif wurde, der Quartettstil ein Teppich und Korrektiv ; z war nidit bei den schlechteren Stiicken, die einfach nur Riickstand sind, aber des to mehr bei den besseren, kontrapunktisch nell aufgcbliihten Kammermusiken, an denen fast alles Durchsiclltige einzuholen blcibt, urn ihre Sophrosyne dcm ebensowohl dcmokratischeren wie transzendenteren Gebilde der Syrnphoric rnitzuteilen.
Beethoven, seine Form, sein Gegenstand
und der Geist der Sonate
:\ bcr nun fallt vollig alles Falsche und Muffige abo Das Blei cntweicht, das Zerrbild verfliegt, und Beethoven folgr bis ans unbekannte Ende. Wie erhebr sich das Herz, wenn es dich, Unelldlicher, denkt! Wir ahnen gewifs, daf noch Herrlicheres erschcinen wird, aber das ist Wunsch und nicht Werk, und so schaumt unsere Seele zu den Sternen auf in dem ersten rauhen,
sturmgepcirsditen, sprechendcn Mcer dieser Musik. Beethoven ist Luzifers guter Sohn, ist der [iihrende Damon zu den letzten Dingen.
Also kommen wir erst hier dazu, offen zu atmen. Mit dem Singen, das sich rundet, geht es freilich fast ganz zu Ende. Auch in seiner thematischen Vcrkiirzung, wenigstens bei den gro~en Satzen, Ausgenommen ist nur das Variieren, wie es stets noch umspielr melodisch bliiht. Selbsrversrandlich auch das langgezogene Adagio, das freilich schon nidir mehr leidet oder ruht, sondern iiberrcdcnd sentimental wird. Das Variieren ist, wie es Bekker gut bestimrnt hat, die Zerfaserung oder innere widerspruchslose Entfaltung, mithin die uberwiegend passive Ausbreitung des hier noch als Lied und Melodie gegebenen, als Gefiihlsreihe auseinandergelegten Themas. Durch die grundsatzliche Aufstellung mehrerer Einfalle unterschieden, schlicfst sich ihm das fast ebenfalls stets noch melodische Rondo an. Es ist so gearbeitet, da~ sich in ihm das lose Aneinander dcr Variationen unter Vermeidung der strengeren Sonatenform zu einer fast rhapsodischen Mannigfaltigkeit von Stirnmungen steigert, gewissermafsen als der Mittelglieder zwischen Gcfuhl und thematischen Gedanken. So stellt das Rondo eine Mischform aus lyrischen Variations- und dramatischen Sonatenelemcnten dar. Bewegter und zugleich strenger wird die Ankniipfung schon im Scherzo, der eigentiirnlichsten Beethovenschen Form, sofern es das alte Menuett rezipiert, im Schein einer r atselvollen, aus Lachen und Verachtung gemischten Freude, ihrer wiitend ausgelassenen oder ironisch leichtschwebenden Tanzrhythmen. Urn abcr zum Wesentlichen, zu den gro~en gebrauchenden Satzen der Senate seiber zu gelangen: Leidensdiafl, Schmerz, Hciterkeir und Gelostheir sind und bleibcn die Teile der Sonate als der cigenrlichen und sarnmelnden Beethovcnschen Form. Ihnen entsprechen, freilich gelegendich mit stark em Bedeutungswechsel, im allgemeinen die Vortragsbe- , zeichnungen des Allegro, Adagio, Scherzo und Finale. Gerade der erste Satz ist zumeist alles andere als ein Allegro, und der letzte, das Finale, nimrnt auch das Rondo, ja selbst die Variation gelegentlich mit herein, die doch sonst der strengen, gegensarz.lidien Durchfiihrung durchaus entgegengesetzt isr, und die sich trotz dcm, eben weil sie beliebig, locker, geloster expan-
42
diert, neben dem ersten Satz zum bedeutendsten Glied der Sonate am Ort des Schlufssarzes ausbildet. Vielleicht bleibt hier auch noch das Beerhovensche Klavierkonzert als eigene Form zu crwahnen. Es spiegelt gewisserrnaflen die iibliche Ordnung von dumpferen Irrgangen und befreitem, leichtem Spiel auf dcr Hochebcne wider. Denn bci Mozart war das Klavier noch cingcordnet, wie es wohl das Thema anschlagt, aber sonst nur untcrhalb des Orchestersatzes figuriert; dagegen Beethoven kennt keine Bewegung, die nicht yom Klavier wieder aufgenommen wiirde und keinen Weg, der nicht das Orchester am Ende vcrIassen mu~te, urn im Klavier, dem wieder aufrauschcnden, prachtvoll kronenden Instrument seine volle Herrlichkcit zu find en. Der iibrige, vor alIem spatere sonatentechnische Klaviersatz als solcher ist nicht so eindeutig, Es liegt nahc, einzclne Sonaten, vor alIem die fur das Hammerklavier, zu instrumentieren, und man hatre eine Symphonie. Beide sind sich nahe verwandt; es lebt in Sonate wie in Symphonie die glciche organisch gegliederte Handlung, von der ja auch die Zeitgenosscn glaubten, hier sci eine verkappte Oper, wie denn die dramatische Aufbauregel Beethovenscher Symphonien in der Tat nicht zu leugnen ist, Bei all solch vollig handlungsmafiigcm, iiberthematischcrn Treiben wird allerdings zur dramatisch verrnehrenden Frage, was denn nun in die Tide des Ganzcn hincinfuhrt, nachdem es das singende Thema nicht ist. Dcnn dieses ist insgesamt seit dem Augenblick, da Beethoven seiner fuhrerischen, kommandierenden, hinwcgreilienden Begabung innc ward, dem Brausen gewichen, dem Drang nach Obcrredung und dem Zug zur Ereignisform. So zeigt sich denn gcrade das Thema bei Beethoven weit davon entfcrrit, als lebendige Individualitat zu gelten; es gibt keinen gro~eren Abstand in diesen symphonischen Werken als den zwischen der Ungehaltenheit des Einzelncn und der gewaltigen Standhafligkeir des Ganzen. Darum geht es auch nidit an, hier alIes Heil aus der oft geriihmten Scharfe der Beethovenschen Themen hcrzuleiten, die, wie Halm gerade an der bilderreichen d-mollSonate gezeigt hat, wo ein Doppelschlag die Oberstimme, eine Tonleiter das Allegrothema und ein Akkord das Largothema bildet, haufig nur auf den Urtatsachen von Dreiklang, Dominanr und Tonika beruhen. Daf die Themen so scharf umris-
43
sen sind, liegt vor al1em am Rhytbmus, der sie iiberhaupt erst prazisc kenntlich macht, und dann, nach den langen Irrgangen der Durchfuhrung, am jetzt, am plotz.lichen wieder-Da des alten, zusammenhaltenden Grundtons und Gesichts. Hier wird der Nebel in das Feuer gegossen, es gibt dunkle Schachte, man fahrt in der Durchfiihrung wie in einem Bergwerk und aus diesem heraus, dem Schein des ersten Themas entgegen, das zuerst wie cine ferne Bogenlampe aussieht, bis es sich plotz lich zum vollen Tageslicht des Freien weitet, der sehnsuchtsvoll erstrebten und nun erst, nachdem sie genornrncn war, mit Gewinn wieder erreichten Tonika dieses ersten Themas. Aber das alles keimt aus einem anderen als dem Thema; es stamrnt aus weniger oder mehr, aus dem An- und Abschwc1len der Err egung, aus Schwanken und Zaudern, Nachlassen, Erlosdien, Zweifeln, Aufsteigen und all den neuen dynamischen Ausdrucksmitteln eines sich wild hinstiirzenden, sich riickhaltlos hingebenden, aussingenden, hinauswagenden Affekts, seiner Beleuchtungswechsel und dem wc1t1ichen Spektakulum seiner Durchfiihrung. Es stammt aus dem barmonisch-rb ytbmiscben Denken, aus dem richtig gesetzten, wohlvorbereiteten , zur rechten Zeit eingetroffenen Akkord, aus der begriffenen Kraft der Kadenz, aus dem J etzt des wieder erlangten Grundtons und der Organisation seines Eintritts, die als Machtfrage ebenfalls eine Rhyrhrnusfrage ist, Es starnmt aus der abstrakten Spannung der zwei Themen, als der beiden verschiedenen Zeugen eines dynamischen Zustands, als der zwei entgegengesetzten Prinzipe, und so worden bei Beethoven sowohl die Schatze der Durchfiihrung wie die Machtigkcir der Hohcpunk te von einern neuen, beziehungsreichen Nacheinandet, mithin von einern Horizontalismus nicht mehr der Linien, sondern erst der gedachrnisrnafsig vergegenwartigten, im Einzelnen vertikal gebauten K omplexe, von einern dazu ausgepragt drama tisch [ormbildenden Kontrapunkt geboren, der seinen Lohn nirgends schon dahin hat.
Derart sieht man hier vcllig in das bewcgte und z eugende, welt1ich ausbrediende Innere herein. Das Ich bridir die kleinen Zelte ab, der Held treibt hinilber in der vollen Kraft seines synthetisdi erweiternden Wesens. Seine Stimme wird an sich schon zu Hilfe- und Emporungsrufen mitten in eine Nadit hin-
44
. der sich kaum mehr die ertrinkende Seele erleuditet
JUS, In • d
.. l t J' a in der allmahlich aile noch so weiten Stern en- un
5lcl, • d d lick
Engelsriiume in Vergessenheit gesunken Sill . Laut ~n ru -
. htslos hebt sich der Schrei des Beethovenschen Subjekts her-
SlC b G" d ch
. dem nichts in dem scheinbaren Le en enuge tut, as no
aus, I U chi' g
"1 or dern hochsten Niveau jeder weltlich rea en ms ie ung
U)c , . b . ds i d
steht, das gleich dem Genius der Musl~ sel er nirgen Siller
'IV eI t vorgebildet ist oder empfangen wird, Das durch aile Skalen der Leidenschaft und Phantastik hindurchfahrt und doch stcts wieder am Ende auf sich, auf 4he Seh.nsucht ~ach de.m Bruder und dem visionaren Vater zuriickgerrieben wird. Es ist hier cine Leidenschaft, das blof innere Leben, die ~eschlossene Stille der Innerlichkeit zu verlassen, die das Ich zu ellle~ wahrhaA: kosmischen Gebilde verwandelt, so hoch und so rief, dag in ihm, ohne sich anzustolien, Sonne, Mond u~d Sterne aufLInd untergehen konnren, und der ganze Urnkreis .der Menschliclikeit seinen Platz findet. Mag auch noch I:Ierrhcheres ko~men dieses sind die Wogen des augeren mysrischen Meere~, bis iibel: die Sterne brandend, und dieses ist das groile romische Reich aus Inwendigkeit, mit seiner Enrdeckung des Geschehens, des Magicrtums und der Geschichtsphilosophie, in dem Wagner unlBruckner geboren sind und allein dereinst der Prophet cler Musik erscheinen kann. Oder anders gesagt: mag Beethoven auch wesentlich nur Umrig sein, noch ohne Ftille; mag man ~Ikin schon beirn Anhoren der nach wie vor ganz unwahrschellllichen Pariser Tannhauser-Ouvcrture, wenn das Ohr in das cluhcndc Nebelreich der Unrerirdischen hineinblickt und zulent baut sich dagegen, dariiber, aus den riesigen ~aulenschaften des Pilgerchors der siegreiche Tempel der Kirche auf -~ mao man dann auch versucht sein zu glauben, Beethoven ser wcscntlich nur ein srerbender Moses, mit Strategie-Blick auf die Bcsitznahme, und hier, bei Wagner, winke von fer~e das ;::clobte Land, das lyrisclie Melisma im rrotz dern drarnatischen KOntrapllnkt: so ist dieses doch alles b~reits .tiberseh~ar, ~ber Beethoven ist nicht iibersehbar, und er liegt nicht weruger iiber Wa"l1er wie Kant tiber Hegel liegt, und wie das unruhvolle Ap;iori'im Menschen tiber jeder Art von allzufriih erfiill tern Objektivismus. Denn das Ich schreitet allein bei Be~tho:en w eirer in die Enrdeckung jenes sicheren Grundes, der sich viel-
45
leicht bis in den letztcn Gott hineincrsrreckr, und die Beethovensche Syrnphonie, das Handeringen, das in ihr, durch sie erlebre Wuhlen von Urgcfiihlen, der Makanthropos und sein sprechendes Meer, dieses in einern einzigen distrahiertcn Cebilde eingefafste Meer, dieser ausgebrochene, externe Traum von Menschenhaftigkeit wirft den krafiigsten Lichtschein des heroisch-mystischen Athcismus, aus Verzweiflung und nicht in Permanenz, gegen den zogernden Himmel. Hier treffen endlich das Wir und das Oberhaupt irn Geiste der Musik zusammen; ein Gedrange von Gesichtern, wie es sich auf den Sdmirzwerken der majestas Christi darstellt, und jener wahrhaft symphonisch ausgeweitete Raum, in dem sich das Wir vernimmt, in dem der zur Briiderlichkeit aufgeteilte Weltgrund widerklingt und das Es dieses musikalischen Cesdiehens zum individuellen Multiversum definierbar wird. Das alles erscheint nun bei Beethoven, diesem groBten Erwahlten des dynarnischen, luziferischen Ceistes, noch durchaus irn Abstand, als blolie gespannte, heroische, synthctische, geistlich luziferische Vision und nicht in gesicherter christlicher Ontologie. Aber wahrend Bach von dem lyrisch gewonnenen Ich des Hoffens aus reder, wenn auch versponnen-vollender redet, und als ewiges Korrektiv fur alles Jenseits der Ereignisform, so riihrt Beethoven ganz anders den Schutt und Zauber des Endes auf mit einer Gewalt, die die drei oberen Stufen, den Glaubcn, die Erleuchtung und die Apokalypse als die Stufen des vollstandigen Ichs wohl betreten kann, genau in demselben MaBe, wie hier Beethoven nicht mehr den erstcn und noch nicht den zweiten Jesus, sondern Luzifer, den Vorkarnpfer, den Keirn des Parakleten, die aktive menschliche Wesenheit seiber zum Schutzherrn und Gegenstand hat.
Strauf], Mahler, Bruckner
Aber noch fiihlt sich hierzu alles gar schwach davor. Freilich auch, es traurnt und briitet dariiber, anders zu sprechen. Vielleichr nicht so sicher schon bci denen, die jetzt leben. Pfitzner, eine feine, bunre Blume, Reger, ein leeres, gefahrliches Konncn und cine Luge dazu. Er weif nicht recht, ungebildet wie er schon ist, ob er Walzer oder Passacaglien schreiben soll,
46
ob er die Totcninsel oder den hundertsten Psalm zu vertonen hat. So sehen Ton und Sprache nicht aus, wenn man morgens an ihrer Quclle sitzt, Wie leer bleibt alles, wenn sich Reger, die unbachischste aller nur denkbaren Erscheinungen, auch nodi gbl.lbig gibt, weil der geborene Anlehner und VariationenLinstlcr gerade formal in diesem Geleise lauf], Er ist nichts, cr h.ir nichts als eine Fingerfertigkeit hoherer Ordnung, und cLls Emporcnde daran bleibt, daf er doch nicht nur nidus ist, cin Quell der bestandigen fruchtlosen Irritierung.
Gauz anders wird uns bei Mahler zumute, diesem heftigen, strcugen, jiidischen Mann. Nom immer reichen die Ohren nicht aus, urn mit diesem Grollcn zu [iihlen und ihn zu verstehen. Er gilt immer noch wesentlich nur als der bedeutende Dirigent, unci mancher elende Zeitungsschrciber wagt durdiaus ohne Schamrote zu fragen, ob Mahler iiberhaupt dazu berufen war, zu komponieren, als ob es sich hier urn die funf oder sechs schwankenden Leistungen eines Harmonieschi.ilers handelte, Fast keines der symphonischen Werke wird aufgefi.ihrt; und w cnn es geschieht, dann bleibt das Ergebnis zumeist ein ver- 1c~;cnes Schweigen oder aber jenes bodenlos gemeine Gesdrwatz vorn Mahlcrschen Ji.ideln oder Schcintitanentum, mit dem sich die sonst alles genicflenden Strohwische vor der ihnen Freilich .ut lrcmden Reinheit des Ernstfalls zurechtfinden. GewiB, er ist nicht mi.ihelos, auch wollen wir nicht sagen, daB der gesucht simple und dcutschtiimclnd sentimentale Kram vieler Mahlerscher Lieder, vor allern die aus des Knaben Wunderhorn, erfrculich oder leicht ertraglich ware. Aber das ist eine Sache, c:r:c k leine Sadie fur sich und ganz ohne Zusammenhang mit dcm iibrigen Mahler, mit der ausschlaggebenden Mehrzahl der ~,bhlerschen Art: es erscheinen die Kindertotenlieder, der letzte GC<ll1g aus dem Lied von der Erde, die zwcite, dritte, siebente Symphonie und die allerernsteste Einlcitungsmusik zum SchluBteil des Faust in der achten, die keiner vergilit, den sie 7u der hochgelegenen und rerrassenforrnig gebauten Berglandsc1nft: der Anachoreren mit hinaufgefi.ihrt hat. Wie oft sich auch dice Achse am Wagen, die blofle Talenrgabe, bei dieser ungcLeu rcn Belastung biegen mag: niemand ist bisher in der Ge\'.z,1 t seclenvollstcr, rauschendster, visionarster Musik dem HImmel nahergetragen worden als dieser sehnsuchtsvolle, hei-
47
lig~, hymnenhaflc Mann. Das Herz bricht auf vor dern Ewig, eWIg, vor dem Urlicht tief innen; wie ein ferner Bote kam dicser Kunstler in seine leere, matte, skeptische Zeit, erhaben in der Gesinnung, unerhorr in der Kraft und mannlichen Glut', seines Pathos, und wahrhalt nahe daran, das letzte Ceheimnis] der Musik iiber Welt und Grabern zu spenden.
Es ist, als ob hier das Blut vcrtauscht ware. Mahler ist deutsch ' oder will wenigstens durchaus als dcutscher Meister geltcn, was ihrn freilich nicht gelingt, denn das ist wahrhaflig Judentum in der Musik, jiidisches Weh und jiidische Inbrunst; und Strau/1 muf es sich gefallen lassen, mit Meyerbeer verglichen zu werden. Es halt sehr schwer, iiber ihn ins rcine zu kommen. Er ist gewohnlich, und man sieht in ihm einen betriebsamen Mann der zu geniefien und das Leben zu nehrncn weiE. Aber dafiir und trotzdem ist Strauf im hochsten Grade gutc Gesellschaft. Er ist auch dort, wo er nichts als schlau ist und Modeerfolge kornponicrt, mitten im cntsetz lichsten Kitsch, durchaus Oberschicht mit frcicn, spielenden, souveranen, weltlaufigen Manieren, aus denen jede Spur des alten deutschen Kleinbiirgerturns verschwunden ist. Er ist weitcrhin gesinnungslos und nimmt sein Material, wo er es findet; abcr zu Zeiten findet cr auch etwas Cutes, in dem Vertrauen auf seine miihelose, unbedenkliche und an sich vdllig naive Frcude am Musizieren; hier einen n~uen weichen Gesang, dort die intervallreichsten Bogen, hicr die neue Art, klein geschlagene Motive wie Mctallsraub einzumischen (wobei StrauE durch Liszts Vorbild vor dem blofsen knochenlosen Klangvibrato Debussys geschiitzt bleibr), dort die Krait und den Glanz eincr thematischen Ccpragtheit, cines Sturrnwinds urn die thernatischcn Blocke herum und eines' rhythmischen Aufschwungs, die auch bei seinem Lehrer Liszt nich t ihresgleichen finden. Dadurch gewinnt Strauli, wie gemein, gehetzt und reifierisch, wie [iistern, siiElich und cudarnon.istis0. auch in:mer sein fcuerwerkcndcs Orchester spielen mag, erne Fiigsarnkcit des Ausdrucks, die ohne Zweifel ein kiinstlcrisches Plus gegen die Sucht des ewigen Feierrons und die Pilotysche Erhabenheit der drohenden Wagnerschule bedeutet, Strauf iiberrascht Freilich zurn grofsen Teil nur deshalb, weil er sich im Grund nicht cnrwickelt und immer wieder auf andere Art stehcn bleibt. Er hat keinen Kern, der anders rei fen miiEte
48
a ls vorn Standchen beliebig hinauf bis zur Elektra und dann wieder herunter, fiir die Bediirfnisse des neuen Gcldadels nach ~:cschlossencr Melodic, zum Rosenkavalier, urn zuletzt, wie es scheint, das Heil in cincr sehr wohlklingendcn, sehr erotischen ~>Eirchenmystik zu versuchcn. Strauf triumphiert iiberwiegend nur mit Schrnif und Sinnlichk eit, den Erbschaften eines Friihen, baurischkrafl igcn, bunten Uberbrettlstils, die er mit eincm ~uEerordentlichen Verstand in seiner Art fruchtbar gemacht hat. Dadurch klingt alles ganz vortreffIich, und es jubelt oft wunderbar in dieser Musik auf; der Schrnif steigert sich zum kontrast icrcndcn Humor, die Sinnlichkeit zu einer zwar niederen und eudamonistischen, aber doch irnmerhin zu einer gewissen soi disant-Mystik: und gewiE doch, wie Eulenspiegel schellt, wie das Licht in der Sendlingergasse erlischt, wie die 'I'iinz c im Zarathustra pfeifen, wie der taumelnde Narraboth vcr l iihrt wird, wie die Hybris Don Juans hindurdischlagt durcli aile Themcn des Verweilens, wie namenlos schon die aus Tad aufsteigende Verklarung durch dreimaligen Vorhalt zur Scligkeit ihrer Tonika gefiihrt wird, wie die silberne Rose aufgliiht, wie die dunk len Akkorde des Orestes aller vorhergehen den Unruhe der Weiberstimmen entgegengestellt sind, wie die Wiedererkennungsszene der Elektra aus dem Motiv des Traucrboten ernporsteigt, wie sich der Gott auf Ariadne niederlaEt: das will gemacht sein, auch noch iibertechnisch gemacht scin, und es gehort cin auEerordentlich krafl ig aufpeirschender, ausniitzcnder Kunstverstand dazu, so strahlend mit seinem Pfund zu wuchern. Aber was hier ausgeniitzt wird, sind doch ~'csentlich nur nervose Gaben; die Seele fehlt, so lyrisdi-erotlSeh auch alles durchwegs gestimmt ist, allein schon das clcnde, Mende!ssohnsche jochanaan-Motiv enthiillt die religiose Seichthci~, Kcrnlosigkeit; - und die Straufsischc Musik tragt an ihren netsten Stellcn bestenfalls die Melancholie genialer Hohlheit In den Augen. Sie ist bewegt genug, urn Kampf und nervosestcn Gegcnstand zu trag en, aber doch nicht so mit Ernst bewq;t, daE daraus auch wirkIiche Weite und mehrsatziges Geschehen entsrehen konnten. Das alles wagt sich nicht vor, trotz der gewaltigen, jubelnden Geste, cs bleibr ein farbiger Scharten, der samtlidicn, auch den undramatischen Einzelheiten des Programms, ja diesen am cindringlichsten nachfolgt; die Liebe
49
zurn weichen, blumigen, atmospharischen Wiener Textbuch hat wohllebige Griinde, und wo es gilt, dramatisch zu schreiben, zehren die Straufiischcn Raucherkerzen jede wahrhafle Wirk- , lichkeit in ihrem Wohlgeruch und in der blof spiegelnden Phantasie untiefer Charakteristik auf. Was also dauernd wirkt, werkhafl prinzipiell, und iiberdies das Blut ist, aus dem bei Srrauf System und Methode quell en, das liegt in der auBerordentlich deskriptiven Krafl dieser Musik, die den malenden Ausdruck auch des Kleinsten, gewiB auch des Trivialsten, Musiklosesten, irides hie und da auch der Fassade des Tieferen Forden und iiberdies mit einem alle Einzelheiten wieder zusammenschmelzenden Schwung das Wunder ciner rein lyrisch, »heidnisch« lyrisch deskriptiven, undramatischen Symphonik erzeugt. Es ist derart nicht zufallig, daB Strauf die einsatzige, die Berlioz-Lisztsdie Form bevorzugt, wahrend nicht nur Schumann und Brahms, sondern was wesentlicher ist, auch Schubert, Mahler und Bruckner als echte Erben des Beethovenschen Geistes die mehrsatzige Form der Symphonic, die Form der dramatischen Weite, die Beethovensche Urform beibehalten haben. So karin jetzt schon scheinen, als ob aus Strauf viel enrwidien ware, das beim ersten Horen anders, krafliger, weniger anistisch schien. Und zwar nicht infolge einer veranderten Beurteilung, sondern eben verrnoge des flieBenden, kurzdauernden, an die Zeit gebundenen reflexiven Inhalts. Man denkt an Sirnmel, auch hier werden stets nur die farbigen, nervosen, rein impressiblen Rander des Lebens gemalt; und Rodin oder Bergson sind die genialischen Reagenten dieses Zustands. So liegt es nahe, Strauf mit dies en beiden anderen Verkiindern ciner wechselfrohen, unzentralen Zeit den Platz zu geben, den die drei widerlegten abseitigen Philosophen in dem Fresko der spanischen Kapelle in Florenz zu den Fii{\en des hI. Thomas innehaben, wobei cs freisteht, Bruckner, der seine neurite Symphonic dem lieben Gott gewidmet hat, zumindesten als den praecursor S. Thomae zu verehren.
Endlich ist mit Bruckner wieder Gesang in die Welt gekommen, cin gutes Gewissen dazu. Von Wagner hat er gelernt, aber das iiberhitzte Wesen, die »blutige- Partitur ist verschwunden. Fs erscheint tatige Bewcglichkeit und sich in sich wandelnde Aus-
50
,crahlung gels tiger Art, geistiger Wesenheiten, schwingende RCJhc, wenn von Bruckner auch mehr noch aus dem »kosrnisellen« denn aus dem »intelligiblen- Reich geschopfl,
Doeh ist er so sorgsam als er wechselreich und tief ist. Was wir an ihm lieben, das ist seine Warme, Wohligkeit und die ganze vrr loren gcwesene Freude am Unterwegs.
lhbei geht die auBerliche, bloB nervose Erhitzung verloren. Abcr wir haben genug an iiberhetzter Spiclart, an Bluff und falsch vcrstandenem faustischem Wesen, das nur deshalb die wilde Cebarde absolut machen rnochte, weil sie die am lcichtest en kopierbare AuBenseite des Konncns ist. Man kann auch Zll k urz werden oder zu leer in ihrcn Spaiten, und hat nicht \X'agner sclber das Adagio als spezifisch deurschcs Tempo gepricsen? Zudem verlangt ja Bruckner gar kein Opfer des echten Temperaments oder gar der echten, gehaltvollen objektiven Stcigerung. Ganz im Gegenteil, sie ist dafiir viel zu kraflig in scincrn glaubigen Trieb nach oben und zudem, allen horbar, in cicrn gliihendcn, siiddcutsdi barocken Prunk seiner Orchesterspr ache begriindet.
Hicr wird sorgfaltig und mit Sauberkeit gearbeitet, auf gute hil!rung der Stimmen gesehen. Dadurch wird also einer der erst en; der kammermusikalische Teppich, eingebolt, Was Bruckner leistet, das ist, kurz gesagt, daB er wieder melismatische, k.munermusikalisdic Kultur der Stimmen eingefiihrt und da:11:[ allerdings den symphonischen Korper entgiftet, das heillt, vo.: a llcr auBerlichen, bloB mit dem Willen und nicht mit dem 'X' crk aufsteigenden Fiebertemperatur befreit hat. Hier ist, wie C .unsky richtig hervorhebt, jede klangliche Steigerung der r;~chtmaBige Ausdruck musikalisch streng vorbereiteter und it'stgehaltener Spannungen, nicht nur, wie bei Beethoven in iihl'rwiegend rhythrnischer, sondern in der ausgearbeiteten, modulatorisch und kontrapunktisch durchdachten Form. Man hi, f rcilich gerade deshalb wieder Bruckner allerlei Bosartiges, sl'hwerfallige und disparate Diktion, Langen und dann wieder Sprlinge und Risse mindestens in den Ecksatzen zum Vorwurf '(''lucht. Wo das nicht cinfach an den Ohren liegt (denn Br~hms hat es Freilich leichter, zusarnmenhangend zu sein, und (ii" Lisztschule nicht minder, der haufig die stirnmungsmaliig "der einfach deskriptiv leitende Kraft des Programms jede
51
strenger musikalische Entwicklung erserzr), dort wird sich dieser Vorwurf, abgeschen yon einigen wenigen unerheblichen, mehr auf Auslassungen beruhenden Verstdfien, miihelos auf das Problem, auch Problematische des Brucknerschen Finale beschranken lassen,
Dieses webt sich a11erdings oft merkwiirdig weit und formlos, liickenhaft zusamrnen. Aber der Ausgang ist an sich sdion, auch bei Beethoven, ein sehr schwieriges Kapitel. Wahrend die Einfalle im ersten Satz durchaus geziigelt und ihre Aufeinandcrfolge nach genau eingehaltencn Regeln geschieht, ist das Ende der Symphonic der alte frdhliche Kehraus, die iiberlieferte Form der Ungebundenheit, weit lockerer gcstaltet, auf Sprung und Flug bedacht, mit beliebig prallenden Gcgensatzcn und ausschweifender Phantasie in der Durchfiihrung, die durch nichts als die Forderung einer moglichst glanzcnden oder niederschmetternden Sieghafligkeit des ersten Themas nochmals geregelt wird. Das war so bei Beethoven und ist bei Bruckner verrnehrt geblieben, der das Finale unbewaltigt und wie cine nur extensiv vollzogene Synthese bestehen laBt. Denn dieses eben ist zumeist so gearbeitct, daf es den Zuhorer larrncnd, wicder auflockernd, formlos in den Alltag entlafit, Mag er nun wieder vors Tor gehen, das Steigern selber hat sich vor der Welt draufsen verbeugt, die allein lctzthin das Konzert beendet. Hier wird der Abschluf zwar auBerlich an den SchluB des Adagios angekniipft, aber er bcstatigt nur das Scherzo, dieses wiedergcfundene Gleichgewicht und den weltlichsten Teil der Symphonic. Dadurch, daf der Sieg am Schluf steht, erweckt selbst das Finale yon Beethovcns c-moll-Syrnphonic den Eindruck, als ob die Wetter, die einherfuhren, die SiiBigkeiten, ja der unersattlich genug ausgekostete Sieg selber nicht ganz als wirklich zu nehrnen waren; wenigstens laBt die Musik a11- zudeutlich das Endc mer ken und fiihrt eigenhandig durch ihr eindringlich verkilndetcs Fertigsein von sich abo Immcrhin , kommt Bruckner in Einem wciter als sclbst Beethoven und das klassische Kapitel des Abgesangs. Bei ihm 5011 das Finale die Menschen nicht auseinandertreiben, es wird vielrnchr als Entriicktwerden zur Musik cntwickelt, als ein Eintritt in den raurnlichsten und objektivsten Teil der Musik iiberhaupt. Man sieht den Bildern der Erinncrung zu und ist vom Drang des
Zcitlichen befreit, im konternplativen Zug iiber die Leidensc:haftcn, Lander und die erklarte Grundfarbe des ganzen gespielten Werks hinwcg, mit der Erwartung visionarer Ausb'llcke und im ganzen mit dem Bewufitsein, an dem geborenen Orr fur lyrisch Ontologisches in der Symphonie zu stehen. Das ist gewiB nicht mehr drama tisch, nachdem es so stark ins Epische zuriicksinkt, aber es ist wahrscheinlich in der Ordnung, dail sich das Dramatische nur im erstcn Satz ausgebart, und daB .icr letzte Satz, das Finale, nun keine neuen Entladungen mehr "infuhrt, fiir die ja vorher Zeit und Exposition genug war, sonder n andere Erhohung, cin neues Adagio setzt (das ja bekanntItch schon in der lyrischen Form die am schwerstcn zu schreibende \I usik ist), mithin geistliche, Brucknersche Epik in der hochsten Geiostheit und eudiaristischen Beendigung hinzubringt.
Hier hernmt nur noch, auch bei Bruckner, die ticfere und bei dem gegenwartigen Stand der Tonkraft nicht aufzuhebende Seh wierigkeit des musikalischen Abgesangs als eines [reudlgen Schluftkapitels uberhaupt. Es ist notwendig zu steigern und aufzulosen, aber sehr oft steht deshalb das Jubeln einfach nur gutycrmittelt da. Das ist so bei Beethoven und Freilich auch bei ])ruckner, ein gesetzt formelles, nicht bewiesenes Streifen der Himmelsnahe, Der jubel kornmt gewif aus dem letzten Erlebnis Beethovens und isr hier kein blolies Appendix der Stei!',crung, keine herki:immlich verbiirgte Klimax, abcr cr kommt nicht aus dcm Musizieren notwendig sclber. So kann das angeh:ingte J ubeln rein musikalisch gar nichts besagen, und wenn man sich nicht mit den Redensarten zufrieden gibt: wie sol1te l' anders sein? Durch Nacht zum Licht! oder Beethoven sei nichr der Mann, der -, nun, der es lange im Diisteren, unher oisch Gedriickten aushiclte, wenn man derart nicht zu den heitcren Panlogisten zahlt, bei denen es unter allen Umstan(kn gut ausgehen mull, und fiir die das Leiden nur cine Wiirze, (inc prachrig sparinendc Zcremonie des verlangerten Unter\'cgs bedeutct: dann kann auch rein musikalisch nichts gleidi;.;tiltiger sein als dieser einfach nur biographisch vorhandenc .l ubcl, der dadurch daf er formcll gut plaziert und mit Tonikawirkung am Ende steht, nichts an eigentlich musikmetaphysisch iiberzeugender Wiirde hinzugewinnt, Die Freude ist stets paradox in allem Crofscn; sic wird auch musikalisch durch die
53
Durdifiihrung, Dominantstcigerung nidit eigcntlidi erzeugt, das heilh, in einem tieferen Sinn herbeigefuhrr, notwcndig herbeigcfiihrt, sondern es miilite hier ein eignes Sprechen, cine »produktive« Durchfiihrung, eine Musik des Sehnens, Rufens, Glaubens, eine Geburt des Glaubens aus der Musik geben, die von der Ieisesten, innersten, fernsten Ticfe der Musikseele her zuletzt das »Sed signifer sanctus Michael- anstimmen konnte - ein Zie!, das auch den bislang gro~tcn Musikern nur sclten zu erreichen gelungen ist und dann zumeist derarr, daB sich die produktive Vision Iieber im Adagio als im Finale mit seiner phantastisdi epischen Gestaltung einzusrcllen pflegte. Indcrn diese dem brennenden seelischcn Kern, der auf einen einzigen Punkt hinwirkenden reinen Selbstvision, dem eigentlich lyrischen Ontologismus zu fern liegt.
Seit kurzem hat Bruckner in Halm einen hingebungsvollen Deuter seines Konncns und seiner Lage gefunden. Er hat gezeigt, da~ Bruckner gibt, was Beethoven nidit mitgegeben hat, bei dem der Gesang in dem grofsen Wurf, in dern energieerfiillten Motiv und in der Kraft, iiber Massen zu herrschen, verloren ging. Dadurch, daB Bruckner solches leistet, wird zugleich der unreine Stachcl poetischer Anlasse fiir irnmer iibcrfliissig; vielrnehr, es isr dieses Meisters Tat, denn Gewinn des Wagnerstils, die »sprechende« Musik, vorn Erziehungszoll des Programms oder Musikdramas endgliltig losgelost und derart - bedeutsamerweise mit dem ganz Anderen bei Brahms zugleich - als Form und Gehalt in Einern, gar als Weg zu anderen Meeren als denen der Pcesie erinnert zu haben. So bezicht sich Bruckner, der Erbe Schubcrts, die Kla rung Wagners, gleichmaliig auf Bach und Beethoven, die er beide wiederum aufeinander bezieht, sofern hier die wohlausgebildere Individualitat des Einzelnen und des Bachschen Themas in der Form der Bccthovenschen Strategic und sozialen Organisation zugleich und aufs liebevollste aufrechterhalten wird.
Zu Wagner
Doch durch einen bliihte all dieses erst auf. Keiner zwar hat schlechter als Wagner begonnen. Er war bedenklich und geschmacklos, und manches davon ist nicht ganz gewichen. Und
54
dennoch: was vor ibm war, ist durch Wagner sehr weir eingeholt. Er wiihlt und schaurnt so viel bisher Gestaltetes zusammen. darnit es wirklich da sei und daran seinen Anfang nchme,
Vorganger
Kurz vorher herrschte offentlich durchaus noch das geschlossene Lied. Aber nun karn von neuem wieder das vor sich Hinsingcn zu Ehren. Wagner brachtc eine vollig neue Art von Melodie, uder richtiger gesagt, einen neuen Weg in Wald und lange vergcsscnes Gebirge. Bis zu ihm war nur mchr die einfache homophon gesetzte Liedweise mit bescheidcnem Taktschlag als Melodie bekannt. Die minderen italicnischen Gesange odcr noch bcsscr, denn wir reden hier von deutscher Linie, die Mendelssohnschen Lieder ohne Worte und die Meyerbeerschen Arien machen diese verarrnte Art vollig klar, die die homophone Begleitung unter sich halt und deren stabiler, synkopenarmer Rhythrnus fast jede anders geschlossene Mehrstirnmigkeit unterdriickt. So auch, obwohl es hier zum Ieiditen Ernst der lyrischen Spieloper notwendig war, bei Mozart als dem groBten Meister der iiberwiegend homophon umspielten Lyrik. Nur bei Lincrn, bei Schubert, scheint der Fall andcrs zu liegen. Hier ist es scheinbar moglich geworden, daB die alte geschlossene Gesangsmelodie auch irn syrnphonischcn Gebrauch bestehen bleibt. Abcr wenn man genauer hinsieht, so ist, wie iibrigens hie und da auch in den begabteren Licdern Schumanns, zum Beispiel in dcrn erstaunlichen »Zwielidit«, - so ist bei Schubert, dem Zeitgenossen des iibelsten Liederfanatismus, ein Doppeltes zu bemerken. Es ist ein weiter Weg vom »Wohin?« bis zum »Erlkonig« oder zur »Nonne«, iiberhaupt yon seinen nur auf cine Stimme angewiesenen und jenen anderen, nicht minder schwelgcrischen und langgezogenen Melodien der Instrumentalwerk c, die nichts mehr mit der allzu weich gearteten, sentimental rnclodiosen Homophonic zu tun haben. Das ist alles durchaus rnelismatisch und polyphon gedacht, mag ihrn auch noch, nicht J.l1dcrs wie bei Weber, trotz Nachtgrauen, oder so gar dem phantastischen Berlioz und dem friihen Wagner selbcr, Kraft llnd Kampf der Gegenstimmen fehlen und das wiedcr weith in ;-iehende, den rcgelmaiiig abteilenden Takt durchschlagende
55
Melos. Bald darauf kam das Neue, Sonderbare, und doch nur fiir den damaligen elenden offentlichen Musikzustand Unerwartete: der Sprechgesang und die unendliche Melodie.
Falsche Polemik
Das war tatsachlich nicht rnchr so leidit zu behalten, Es war weder rnitsummbar noch iiberhaupt fiir sich transportabel. Der damalige Bourgeois war allerdings gewohnt, sich an dem gerne und griindlich trivialisierbaren Zeug der damaligen homophonen Liedmacherei als der »Mclodie« schlechthin zu vergnligen. Nur so war es rnoglich, da6 die Beziehungen zu Bach so bosartig verkannt werdcn konnten, die sich schon in der Romerzahlung hiniiberspannten, mitten in dem noch so unleidlich homophon gehaltenen Tannhauser. Was wurde nicht alles dagcgen vorgcbracht und an Gemeinheit ausgegraben! Und heute ist man wieder dabei angclangt, daB sidi die vcrlogensten Schwarzer dort zu moral as thetis chen Richtern erheben, wo sclbst Beethoven mit dcm Hut in der Hand getadelt hatte. Was wurdc nichr alles dagegen vorgebracht, zuerst von den kleinsiichtigen, blicklosen Schuften, die an allem Bedeutenden, das ihnen erscheint, immer nur ihre eigene Gemcinhcit crlernen, und dann von den Liebhabern der florentinischen Landschaft und alles dessen, was den Garten start des gotischen Waldes erwahlt, - gegen das [ortwahrende Modulieren, gegen die Wagnersche Erfindungslosigkeit und Gestaltungsschwache, gegen die sich in ewigen Trugschliissen aufreibende Melodie, gegen die extreme Irritabilitat ohne Kornma und das langweilig niichterne Psalmodieren, zu dem die Sanger iiber einem gestaltlos wogenden, bestenfalls realistisch malcnden Orchester gezwungen werden. Wahrlich, wenn je etwas einfach und alt war und das angestammte Erbe bewahrte und rnehrte, so ist es dieser Sturz der gesdilosscnen und die Geburt der unendlichen Melodic gewesen. Und zwar nicht als ob hier bloB auBerlich verbunden ware; was denn konnte darin vorher zerbrochcn gewesen sein? Sollen es, etwa wei I er sie nicht anfertigen »konnte«, die alten Opernpiecen sein? Die hat Wagner sicherlich nicht zerschlagcn, urn sie dann mit kalt berechnetem pele-mele, mit angsrlicher Vermeidung aller Halb- und Ganzkadenzen,
56
ins Endlose wieder zusammenzusetzen. Wie oder wo konnte sich hier, wie es bei Weber wohl noch scheinen mag, ein blofles Konglomerat bemerkbar machen, nachdem es keinen Ton in dies en gcrade Bach so nahen »Praludien« gibt, der aus der andauernden Dominantspannung herausfallcn konnte oder modite? Es ist die neue melisrnatisdi-polyphone Form iiberhaupt, so schr, da6 der Meister nur mit Gewalt nach dem Auftreten \'if ebers, nach der Erscheinung der Beethovenschen Symphonie und der Rezeption dcr Bachschen Polyphonie vor dieser imm.incnten Entwicklungslinie harte Halt machen konnen. GewiE ist das alles, wie wir sagten, nicht mehr so leicht zu behalten und in der oberen Stirnrne, vor allem, wenn es sich urn das cinfach erzahlende Rezitativ handelte, auch nicht immer mit Gewinn gclungen. Ferner ist die Form der hinausgeschobenen F.ntscheidung ihrem buchstablichen Sinn nach immer nur am Ende als Gestalt, Uberblickbarkeit und »Forrn« zu erkennen, mit der ganzen Tugend ihrer riesigen Bogen, ihrer sparsamen Kadenz und der Dominantspannung cines ganzen, scheinbar nur pcctisch versammelnden Aktes. Aber daraus ergibt sich 110ch nicht das Recht, die wei ten und berechtigten Bewegungen der unendlichen Melodie mit der davon vollig verschiedenen, und allerdings sachlich bedenklichen Verschmelzun g des Gesarntkunstwerks in eincm einzigen Arernzug zu nennen und mit zu verwerfen. Es ist ersichtlich etwas anderes, ob die kleinen Formen des alten Opernschemas mittelst einer neuen grolsen Form aus ganz anderen Reihen abgelost werden oder ob ctwas halb verwandt nebeneinander bestchen bleibt, urn gegenseitig seiner Struktur und Sphare abzuschworen und so in dem AusLausch musikalischer und poetischer Bestandteile dieses Mischgcbilde des Gesamtkunstwerks zu erzcugen, wie es nur durch Wagners Genie zu einer lebensfahigen, wenngleich prinzipiell unkanonischen Kategorie werden konnte. Technisch freilich hrauchte Wagner beides, sowohl die offene Zuordnung des Sprechgesangs und arios gewordenen Rezitativs wic die unge.ieurc, problematische Hilfskonstrukrion des Gesamtkunstwcrks wider aile Sphare und Plastiz itat, - urn dergestalt mittcls solch maliloser Totalitat die ihr entsprechensollcndc Schicksalsmusik zu gewinnen.
57
Sprechgesang, synkopisdier Rhythmus
und akkordische Polyphonie
Nun wird das Singen nur zur einen Stimrne unter vielen. Das kann schmiegsam, kurz und blof erzahlend sein. Der Gesang kann auch arios aufbliihcn, mit Breite und aller nur wiinschenswerten Ausladung, erhoben, klangvoll und pathetisch genug. Freilich, cs ist oft schwerfallig und errniidend, wie Wagner oben durchkomponiert; es fchlt ein Ab- und Zugeben, zuweilen wiinscht man wieder die Trennung zwischen Teig und Fiillung, Gesprach und Gesang zuriick. Immerhin, jetzt klingen aIle Stimmen, und der Gesang taucht bcliebig oft unter, von den andcren Stimmen, wenn sie mehr zu geben haben, reich iiberflutet irn wechselscitig verflochtenen Spiel. Man kann derart sagen, bei Wagner verzichtet die menschliche Stirnme, die vorher alles trug und nun ihre ganze Entwicklung zur vokalen Mehrstimrnigkeit dem Orchcstcr abgegeben hat, auf den dlirftigen Rest, dem Gange allein noch mclodisch zu prasidieren und zieht sich, vollig frei geworden und unbelastet, wieder auf das vor sich Hinslngen, auf ihren Ausgang und ersten schweifenden, psalmodierenden Zustand zuriick.
Das Weitere wurde durch Tanz und synkopische Wirkung erlcichtert. Sic ist von Beethoven wesentlich erfunden und von Wagner so sehr zur vollen Ausbildung gebracht worden, dag man bei ihm, so in dem fast durchgchends synkopierten Tristan, aIle ihre Falle erlernen kann. Es ist ein Schleppen oder Vorwartsdrangen, cin Retardieren oder Antezipieren des melodischen Zugs; oder wie Grunsky die Synkope gegen Riemann zum ersten Mal richrig besrirnmr hat, ein neuartiges Herausholen und Neubetonen taktrnaiiig unbetonter StelIen, ein Neues im Takt, ein Spannen und sich Messen des Betonten am Unbetonten wie des Unbetonten am Beronten, wodurch es vermittelst der Reibungen, die durch das Ncbenher verschieden gcteilter Zeiten entstehen, moglich wird, mehrere Rhythmen, wenn auch nur am StoB beirn Taktende Fiihlbar, gleichzeitig durchzufiihren, Dadurch, Freilich nicht dadurch allein, wird der Takt vielhaltig durchschlagen, ja man kann mit lehrreichcr Obertreibung sagen, jetzt wandelt sich ein Takt in tausend
58
I "
Ta kte, uud cler Platz Iur jede Mehrstimmigkeit ist mit der unstabilen. synkopenreichen Polyrhythmik bereiret. Jede der viclcn zugleich erklingenden Stimrnen hat wieder etwas zu spielcn, ihr Solo zu spielen ; das Melisma bindet sich an die Harmonie, die Harmonie an den Rhythmus und dieser an das lnsgesamt des jetzt nicht mehr nur leer, unverschmolzen, augerharmonisch, sondcrn rein harmonisch und dariiber noch musikdrama tisch gehorten neuen Zeirenbaus der Synkope.
Darunter ist also nicht mehr das leichte Schweben zu verstehen. Lher noch durfle hicr alter Bauerntanz die krafligere Bewegung crhalten haben. Noch heute gibr es bei allen wilden Volkerschallcn ein iiberwechselnd gehcimnisvolles WirbeIn, und von da bis zum Tanz der Derwische und Davids Tanz vor der Bundcslade ist vielleicht nicht einrnal ein Schritt. Diese Drehung ist nicht nur leiblich rauschhaft, als Gestalt von Jagd, Begicr und manchcrlei Zuckung, sondern dariiber noch durdiaus stcrnhafl bestimmt. Die tanzeriden Derwischc nehmen fur sich an dem Tanz der Huri, ja der Engel teil, im Rundtanz und der Drehung urn die eigene Achse, bis Krampfe, Ohnmacht LInd siderische Ekstase folgten. Denn die Huri gelten als die Geister der Sterne, die die Geschicke lenken; indem der Derwisch also sich in diese Drehung abbildend hineindrangt, sucht cr den Gestirnen konform zu werden, den Erguf des primus :l2;cns aufzunehmen, auf sich herabzuziehen, urn das die Gest ir ne kreisen, dessen ewige Glorie die Sterne allerriachst ansc!l:lUcn. Dergestalt also nahm der tanzende Derwisch, wie Ibn Tufail erlauterte, die verschiedenen Arten der Kreisbewegung .lIs Pt1icht iiber sich; ja selbst noch Dionysios Areopagita pries die krcisfdrrnige Bewegung der Seele als ihre Einkehr in sich c'['illst, Freilich bereits nicht mehr aus Griinden der Abbildung des Zirkcls der Gestirngeister der sideris chen Sphareridrehung, soudern - unter beginnender Abtrennung von aller dionysi\chen oder mithriiischen Ekstase - aus Griinden der zyklisch l'rfolgenden Einkehr der Seele in das Schone und Gute ihres cigcnen Grundes. So wurde dann zuletzt jegliche aug ere Zukkung von den friihchristlichen Gemeinden als heidnisch abgelvhnr. Das heiBt, der Gesang, der den Tanz begleitcte, blieb als rvligioses ErregungsmitteI, aber wie der buhlerische Klang der ] mtrumente verabscheut wurde, so schienen auch die lebhaft
59
und wechselvoll geteilten Zcitrnafie des alten Tanzes der Meeresstille des christlichen Gemuts zu widersprechen. Derarr entstand der blof harmonisch angedeutcte Taktwechsel des Chorals, - antiheidnisch frei von jeder Spannung, wenn man nicht sdion in. der ruhigsten Bewegung zur Tonika eine Spannung sehen will. Wahrscheinlich ist auch, so wenig wir jetzt darum herum konnen, die Auffassung der betonten Note vor dem Atemzeichen als einer rhythmisch gliedernden Fcrmate irn Choral nichr alt. Anders wurde erst das Bild, als die italienischen und franzosischen Meister der galanten Musik erschienen. S!e griffen jedoch in ihrer Sucht nach lebhafterer Bewegung nicht zu den alten Bauerntanzen zuriick. Sondern wie die steif gewordenen Mcnsdien vor kurzem noch nichts anderes als den Walze~ tanze~ konntcn, so machte man sich darnals (es war zwar em grazioses Geschlecht und, wie die Gigue beweist, bedeutere der Sprung von der Kirmes zum Ball nicht unbedincr den Verlust aller raffinierteren Zeitmafsc) eine gewisse leicht~, federnde und doch wieder hdchst reizvoll gehcmmte Schwebung in Gleichmafligkeir zurcdit, die den Tonschritt ebensosehr i~ S0wung erhalr wie sie die weitcre Konsequenz, das mehrstirnmige Durcheinander der Synkope, noch verbietet. Zwar war schon Fruher durch die Einfiihrung der mensurierten Notenschrifl: der Weg zum geteilteren Takt frei geworden. Aber das alles hing malilos ins Unausfiihrbare, klanclich und kiinstlerisch Gleichgultige, in die Schauparritur u~d blofle Theorie heruber. Darum konnte das erst anders werden, als vor ~llem ?urch Bach der alte Volkstanz mit rezipiert wurde, der ja welt zuriickreicht, vieles Primitive treu bewahrt hat u~d, .. w_ie noch jede ungarische Zigeunermusik bezeugr, dem viclfaltigercn Rhythrnus polyphonischer Musik nicht allzu fern steht. So hat Bach in einer Weise rhythmisierr - wir erinnern hier nur an die Arie »Erbarrne dich mein. aus der Matthauspassion oder an die zahlreichen » Umarbeitungen« der franzosischcn Tanzformen in den Partiten -, die wie die wiedergewonnene, selbstverstandlich ungewollt und ungewufst wiedergewonnene primitive, heidnisch kultische Steinschlag- und !rommelrhythmik wirkt, Aber nun zieht gerade dieses auch jenes sonderbare, ungerufene sich Berauschen erneut heriiber, das nichr nur seelisch ist. Man weiG, wie zutreffend Wagner
60
Beethoven durch den Tanz, durch das Packen, Atmen, die Pulskurve erlauterr hat. Das hinderte Wagner Freilich nicht, ink ons~quellterweise, die Tanzform, wei I er sich nur an ihr gesellschaftliches, banal eurhythmisches Vorkommen halt, aus dem Tonzusammenhang letzthin herauszudenken. Es ist merk wiirdig genug, daG Wagner, nachdem er das bekannre Wort von dcr achtcn Bcethovensdien Symphonie als der Apotheose des Tanzes gepragt hat, nun doch wieder der Beethovenschen Kunst, und zwar eben wegen dieser ihrer Tanzgebundenheit, das Verrnogen abspricht, gewissc Grenzen des musikalischen Ausdrucks zu iiberschreiten. Wohl stirnrnte der Tanzrhythmus, sofern ihn sidi Wagner lediglich als akustisdies Ballett, als Kalcidoskop furs Ohr definiert, in dieser Form auch die leidenschaftliche und tragische Tendenz so rief herab, daG die Frage nach einern Warum, nach einem dem Tongeschehen an sich vollkommen fremden empirischen Kausalzusammenhang unvermcidlich wird. So war Wagner nie geneigt, das rhythmisdie Moment besonders hoch einzuschatzen, in dem er, selbst unermiidlich in der Aufstellung rhythmischer Probleme, und dazu noch der erklarte Liebhaber der tonenden Gcbarde und aller thcatralischen Versinnbildlichung, dennoch nur eine Beriihrung, cin Tertium compararionis mit der anschaulichen plastischen Welt sah, wodurch, wie das Licht am Korper, so auch die Musik gemaG dem niederen Sinn einer empirischen Realitat erst wahrnehmbar wiirde, Jedoch wichtig ist hier nur das Eine, /vusschlaggcbende, daf sich Wagner, trotz all dieser gesellschnfls-, ja weltfeindlichen Vorbehalte, dennoch als Beschworer ur d Erneucrer des orgiastischen Dionysos definieren lieG, sobald dieser nur in einer vollig idealischen Form als dramatische \ktion erschcinr und demgcmaf auch der Beziehung auf die lc.dcnschafilichen, tragischen und transzendenten Tendenzen der Musik fahig wird. So ist also zugleich mit dem vor sich ll insingen, mit der Rezeption des Tanzes und mit der kammermusikallschen Feinheit, die in Wagner-Bruckner ihr Orchester f;1nd, der ganze erste, noch namenlose echte Teppich des primit ncn lind des korrekten Reichtums eingebolt, Aber gerade in'.iem die synkopische Wirkung von dem neualten Tanz Untertlitzung erfahrt, bleibt dieser feurige Rhythmus nicht nur wie c.n Teppich mit sachlich und gegenstandlich zu nichts verpflidi-
61
tend em Korrektivwert zu den EiBen der Wagnerschen Polyphonie liegen, sondern sachlich eben geht auch das uralt inkarnierte Heidentum mit, sowohl urn seinen dionysischen Charakter mitzuteilen, als auch urn der Musik allerlei rauschhafte Selbstvernichtungen, Diktatur des Unterleibs, physiologisch erd-, ja sterngebundene, dionysisch-mithraische, astralische Transzendenzen vorzuschreiben.
Das Dritte und Wichtigste, das zum bunten, vielstimmigen, dabei drarnatisclicn Gewebe unendlicher Melodie fiihrte, ist die Harmonie. Schon irn Gesang ist jeder Ton bewegt und tatig. Das heiBt, schon in der einstimrnigen Reihe ist der Ton auf den Akkord hin tatig. Oberall stammt der Tonschritt aus dem Dominant- und Kadcnzgefiihl, wird dadurch gefiihrt und melodisch gezogen. Solange man daher auch ohne aile harrnonisdien Kenntnisse gesungen haben mag, so entschieden war doch von jeher die Tonleiter und dann die iiberspringenden Verwaridtschaften in ihr, also zuletzt die Harmonic, treibende und verborgene Ursache. "Die iiberraschende Wirkung, welche viele nur dem Naturgenie des Komponisten zuschreiben, erzielt man oft genug ganz Ieichr durch richtige Anwendung und Auflosung der verrninderten Septimakkorde.« Das ist von Beethoven selbst gesagt und, wie noch zu zeigen sein wird, zweifelsohne wohl imstande, im Bund einer anders rhythmischen Harmonic, weite Strecken seiner Praxis, so den ganzen Hauptsatz seiner lerzten Son ate zu erleuchten. Jedenfalls gehen und bewegen sich aile Tone, es ist ein Schrciten in ihnen, ein Lciten und Geleitetwerden, die Terz will aufwarts, die Septirne abwarts gehen, bis sich der Wille der Tonart durchsetzt und die schlufsforrnige Konsonanz erscheint. Aber auch sie ist nicht eigentlich da: wo Konsonanz zuerst noch ohne harmonische Vorbcreitung klingt, ist sie das denkbar Gleichgiiltigste, und wo sic zulctzt, und sei es selbst nach den Schauern der grandiosesten Generalpause, wahrhaft »ersdieint«, sind doch, wie Bruckner am glanzendsten gezeigt hat, vor allem im ersten Satz seiner siebenten Symphonie, immer noch solche unendliche Spannungswirkungen, solche unendliche Steigerungen auf der Dominant und den Dominantwirkungen vor der Konsonanz rnoglich, daf Halm mit Recht sagen kann: sic geschieht nicht, die Konsonanz, sie lebt nicht denn als Forderung, die Geschichte der Musik ist die
62
Geschichte der Dissonanz. Wo sollte sich also sonst noch ein Anlali, ein Zwang oder eine Leitregel des findens aufzeigen lassen als im Akkord und der Harmonik? Bach ist groB, und die Fuge ist eine unvergelilidie Mahnung: aber worin er fortwirkt, das ist bei Beethoven wie bei Wagner wesentlich Baeh als reich durchbrochener Harmonist. Er mufste sich trotz des erstaunlichen Vergcssens seiner Werke in dem Maile selber wieder in Erinnerung bringen, als man die homophon melodische Satzweise aufgab und wieder zum polyphonen Geschehen iibcrging, das von neuem streng wurde und aile Stirnmen hrauchte, urn polyphones Akkordleben zu erlangen. GewiB sind die homophon melodiosen Meister von der aullerordenrItch reich gestuften Stirnmfiihrung der alten Zeit weir entfernt: aber bercits bcirn Anblick einzclner Gebilde Haydns, der oft r.irselhafl ernst und tief werden kann, etwa des Chors des Hollcngeisrersturzcs oder der Ouvertiire zur Schopfung, zeigt sich cine so iiberraschend kiiline, durchaus schon romantische und glcichzeitig restlos aus Bachs harmonischen »Zufalligkeiten« gczogene Harmonik, daB man sogar geneigt wird, alles, was nachher kam, die ganze romantisch-klassische Chromatik und Polyphonic als das bewegliche, interessant gewordene Arbeirenlasscn der bei Bach auf ruhigeren Raum gespannten Feder zu betrachten. Sicher ist das Eine daran richtig, daf sich, nach eincrn anfanglichen homophonen Verlust, immer reicheres Solospielen, innerlich-einzelnes Musizieren und karnmermusikalisch lineares Melisma in Haydn-Beethovens-Sonatensatz wieder ausbilden mochte, und daB der, wohlverstanden: harrnouisch-rhythmisch, mit dem Akkordziel gebrauchte Bachsche 1\ onrrapunkt deutlich in der Wagnerschen Polyphonie, in einer l'olyphonie hoherer Ordnung als der nicht mehr architektoni«hen, sondern drarnatischen Kontrapunktik Iortwirkt. Nicht rur, daB die neue orchestrale Farbe abhebt, abstuft und wieder \ on selbst schon sinnlich kontrapunktiert, auch die Durchfiihrung riickt bei Wagner an die oberste Stelle und erlangt in Ihrer rastlosen Harmonie - iiber allem nur mehr voriibergehcnd und keineswegs, wie bei Beethoven, als Zie! fixierten Moti. oder Thema erbaut - eine Bachs verschwiegenen Vertikalisrnus rezipierende, das heiBt dem Akkord mehr zu- als abge\\-,lndte form aufsteigender dramatiseher Polyphonie. Mithin:
63
I
das akkordische Leben ist kein Produkt, sondern ein Prius, und zwar keineswegs nur eines theoretischer Art. Gegen das Harmonische gehalren, ist der Kontrapunkt, wenigstens der auf das Lesen und Komponieren der Fuge eingestellte, eine Arbeitsweise zwciter, von Harmonie und Symphonik unterdes iiberbotener Ordnung, die in der getrennten Stockwerkbildung ihrer Melodien auf Schritt und Tritt die akkordischen »Resultate«, Dissonanzen und auch akkordisch-rhythmisch Betontes, Zusammcngefafstes beriicksichtigen mull. So mag es auch dasselbe bedeuten, nur in einer anderen Ausdrucksweise, ob man den Bau eines Wagnerschen Gebildes unter dem Gesichtspunkt der harrnonischen Dkonomie betrachtct, die Freilich ncch sehr der Erganzung durch eine Rhythmik bediirfte, oder ob man die nodi vollig ausstehcnde Bautheorie des Wagnerstils unter dem Gesichtspunkt eines neuen, nicht sowohl im Nebeneinander, Obereinander als vielmehr im Nacheinander entwickelten Kontrapunkts zu entwerfen sucht, der alles nur »zufallig« Harmonische der Fuge abgestreift und eben das Plus der harrnonischen Spannungen, rhythmischcn Kontraste, thernatischen Durchfiihrungen, kurz, die gesamten Kornplexrelationen der »Syrnphonie« hinzugewonncn hat. Was darum bei Beethoven zuerst auflebt und bei Wagner bis jetzt wenigstens kulminiert, das ist in erster Linie Bach als reich durchbrochener, polyphoner, vcrtikaler Harmonist, wahrend allerdings letzthin die lineare Arbeit mittelst des kammermusikalischcn Teppichs immer noch weit krafliger, und das Ontologische mittelst des Palestrinensischen, seraphischen Akkordteppichs bei Wagner immer nodi weir sinnfalliger einwirkt als mittclst des Teppichs der Bachschen Fuge, des lyrisdi kontrapunktischen Gleichgewichts oder Rubeseins. Dieses Freilich ist der Teppich und das Korrcktiv, dessen Einholung, als letzte musikalisch mogliche und postulierbare Rezeption, erst an dem noch unsichtbaren Ende der Musik steht. Es gibt ein doppeltes Singen und Stiirmen, das in der Tonleiter und das irn Akkordleben, also das des linearen Bach und das des iibergreifendcn, vertikalen Bach, hineingefiihrt in die Gegensatzreihen der Symphonie; und Wagner hat, so vehement oder feierlich er auch die Tonleiter meistert, doch vorab der durchbrochenen akkordischen Vitalitat zum Vorrang vor dem linearen Konrrapunkt verholfen. Insoweit sie am meisten
64
das Feuer der Melismen gegenseing steigert, verschmilzt und behurer und derart zugleich das beziehungsreiche N acheinander des neuen harmonischen K ontrapunktes am [ruchtbarsten glieder lallt.
So ist das sonatenhafte Stiirrnen auch wieder schwer und diiflereich geworden. So haben also die drei Weisen: Schrei oder cingeholter Teppich des vor sich Hinsingens, Synkope oder eingcholter Teppich des primitiven Tanzes, drarnatisch verwendete Harmonie oder eingeholre Teppiche kammerrnusikalischer Feinheit und seraphischen Akkordscheins - im symphonischdramatischen Gebrauch letzthin sichergestellt, Es ist erstaunlieh, wie sehr das Symphonische dazu neigt, das Gesangvolle erst zu morden, dann dynamisch neu auslaufend und verschlungen zu schenken; wie kraflig erst die Lust am Melisma zur wahrhaft handelnden Musik, zur wahrhaften Beseelung und Menschwerdung ihres Mechanismus gefiihrt haben. Erst indem Wagner keinen Ton schrciben mochte, der nidit als Zeichen cines Badisdien Lyrismus inmitten seiner dramatisdien, metadrarnatischen Sonatenform harte gel ten konnen, ist, wie Nietzsche sagt, begonnen worden, das ungewulite Musikgebiet nicht nur mit Ethos, sondern auch mit transzendentalem Pathos, also mit mystischem Gewinn zu erschliefien.
Die transzendente Oper und ihr Objekt Noch aber steht Mozarts Erfiillung aus.
Auch er, der Linde, zart Bewegende, schaurnr hier Fertig auf. \\?ir sprechen dabei nicht vom Hollander, Tannhauser oder Lohengrin, auch nidit von dem Wunderbau der Meistersinger, die trotz mancher Ubergange allesamt Handlungsopern auf dem von Beethoven im Fidelio beschrittenen Weg darstellen. Noch weniger isthier der Ring gemeint, der dem heidnischen Tanz ·mtcrliegt und derart vielfach ins Leere und triibgeworden Tierische hineintreibt, Sondern dafiir kommen vor allem Tristan und Parsifal als Geioinn-Eriiillungen der Mozartschen Miirchenoper in Betrachr, als Steigerungen des Linden, zart Bewegenden, das keine Schicksal fordernden Menschen braudite, urn z urn grofien weltlichen Ich zu gelangen und zu seinem Um<.dllag in dem Akt der Erlosung, In dieser aber treten die
65
sft,.sx,z ::;«
.'",·_QA_flit,
Menschen aus dem Schicksal wieder hervor, damit im heimat-, rnythosbildenden musikalischen Raum das metadramatisdie Lyrisma der Erlosung als eigentlicher Gegenstand der transzendent en Oper ersdieine: im Tristan beginnend.
Nun schreiten wir so leise als rief in uns selber. Die anderen sind bewegt und fiihren immer wieder nach auflen, Tristan und Isolde sind dem lauten Tag entronnen, handeln nicht. Es ist unser eigenes tiefinneres Traumen, dort zu finden, wo die Worte und die Schritte nicht mehr eilen. Wir sind es, die mitgehen, wir triiben uns chroma tisch, wir bewegen uns in Sehnsucht und schwimmen dem Traum entgegen, der in der vorriickenden N achr sich bildet.
Das ist schon am Vorspiel zu sehen, wie es zeitlos entfiihrr, Denn es spinnt nur das eine geschichtslose, abstrakte Sehnsuchtsrnotiv, vollig beriihrungslos, freischwebend, jedoch bereit, zu fallen und sich zu verkorpern. Sein Orr wird hell, aber gleich dahinter wieder bleibt alles fern und ruhig. Nur der erstc Akt ladet, er fiihrt die beiden Menschen vom Tag hinweg. Hier geht es noch schrill und hohnend zu, allzu bewulit, und der Todestrank bringt vor das falsche Tor. Aber weder Isolde noch auch Tristan bediirften dieses Tranks, urn sich zu finden. Sie gehen nur scheinbar aneinander vorilber, auBerlich, im ungewissen Schimmer des Tags, der ihnen, den Nachtsichtigen, das allbereits Erschienene noch verschleiert. Isolde glaubt zu hassen, wo nichts als verratene Liebe durchbricht, und Tristan ist so starr, so ungemaf auf Sitte bcdadit, so sonderbar weich, dabei ungelenk und verstellt, daf den beiden der Trank nur das gibt, was sie langst besafsen, was Schicksal ist und nun auch in die Zeit einbricht, Geschick wird, vermittelt durch ein Symbol des Sprungs. Hier biegt sich nichts nur wieder zusarnmen wie im Ring, wo Hagen fiir Siegfried den umgekehrren Trank wiirzt, damit ihm Fernes nichr entfalle; als ein Femes, das in der Handlung liegt, das wiederholt werden kann und nur deshalb Wiedererinnerung ist, wei I der Siegfried der Handlung die Stelle kennt, wo Waldvoglein, Briinhildenstein und Feuerzauber wirken, Aber das, was an oder hinter dem irisdien Trunk geschieht, ist niernals Handlung; er ist nicht einmal ein Schliisscl, nicht einmal ein Katalysator, nicht einmal jener Zufall, der keiner ist und den die tragische Notwendigkeir als
66
Helfershelfer des Schicksals einbeziehr, sondern, wenn anders auch diescs, wo man niernals war, Heimat sein kann, nur ein zeitlicher Anblick eine zeitliche Distrahierung dessen, was ewig geschieht, im Uberzeitlidien, Myrhischen der Liebe gesdiieht. Zwei Menschen sdireiren hier in die Nacht; sie gehen von einer \v'c1t in die andere iiber, sonst begibt sich nichts, schlieBlich auch im ersten und vollkommen in den beiden letzten Akten erkennbar, und nidits erklingt als die Musik dieses Schreitens un d schlielllichen Entschwindens. Das wollte Wagner zu erkennen geben, als er Tristan eine blofse »Handlung« nannte ; es ist cin namenloser Zug, ein ungeheures Adagio, in das kaum ein Gegcnsatz liches von auGen in der Weise hereindringt, daB es Tristan und Isolde iiberhaupt als Konflikr, als Katastrophe bewullt werden konntc: und dieses eben ist der Sinn der »Handlung« auf dem Titelblatt, nicht als ob sie eine ware, sondern 11m zum Unterschied von der eigentlich dramatischen Bewegtheir und Wichtigkeit, von den Tagesgeschicken des antithetischcn, symphonischen Satzes oder auch Musikdramas.
Nur die letzren Bilder sind noch bewegt, sich auBerlich sichrbar bcenclend. Vielleicht ist das biihnentechnisch notwendig, aber man kann sich mit Pfitzner des Eindrucks nicht erwehren, daB damit wieder Tag hereinfallr, und zwar gerade dort, wo man a rn cmpfindlichsren dagegen geworden ist, Es ist uberdies nach dem Gesagren klar, daB hier die Wiederholung nicht diejenige \'Cirkung ausiibt, die ihr sonstwie symphonisch sicher ist. Man ftihlt, wie es hier zu sinken beginnt, wie hier der reine Seelenwcg ve rlassen wird, der nidits wiederkehren lassen kann, und ,hil man dieses alles im grofsen Schluliduett des zweiten Aktes ,chon urn so vieles schoner gebort hat als im Orchestersatz am Schlull des dritten Aktes, der eben unterwegs nichts erlebt hahrn leann ; sofern jedes eigenrliche Fortschreiten fehlte, und der dvshalb auch nicht als das wiedererreichte jetzr, als Reprise und Schlu!\stiick einer symphonischen Durdifiihrung zu figurieren vcrmag. Wie denn iiberhaupt bei aller Verehrung gesagt werden lIlull, daB das so sehr bewufst und finalehaft, gleichsam Irctnsportierbar eingefiigte Orchesterstiick »Isoldens Liebestod« ;n ein unleidlich Weiches, in ein amystisch SiiBes zu sinken beginnt, das ahnlich wie bei den aufgelosten Dreiklangen, bei der ,cchzigfachen, nidir endenwollenden Feierlichkeit am Sdiluf]
67
des Parsifal urn so jaher von der ungeheuren Hohe herabzufallen droht, je schwieriger sich der gute Theatersdilufl mit dem ganz anders Definitiven einer Geburt der Erlosung aus dem Geist der Musik verbinden will. Es wurde so wenig mehr, gesprochen und die Nacht der Liebe ist im zweiten Akt so welterlosend tief iiber uns hereingebrochen, daf] wir nicht mehr das Sterben seiber auf der Biihne zu sehen wiinschen, als welches uns dort Leichen und Urnstehende und geruhrte Einsegnung zu bewundern gibt, wo das Freilich undarstellbarere sich Begegnen in der Weltennacht seinen art harte. Wenn Siegfried stirbt und die Mannen seine Leiche iiber die Felsenhohcn langsam davontragen, dann klingt so lange Trauermusik, als der Zug noch sichtbar ist, Aber bald steig en Nebel auf aus dem Rhein, die uns die Szene verhiillen, und nun erklingt der merkwiirdige, iibersdrwdngliche Jubel cines Zwischenspiels, das mit dem Herkornmlichen eines Trostgesangs oder sonstiger Trauerkategorien nicht das geringste gemein hat. Erst wenn sich die Nebel wieder verreilen, wenn es zu uns, den Zuriickgebliebenen, zu unserer Welt wieder zuriickgeht, kehrt auch die Trauermusik wieder, furchtbarer und driickender als zuvor, sofern eben die blolie untere sichtbare Welt urn Siegfrieds Leiche start des undarstellbaren, schlechthin nur musikalisch zu wahrenden Paradoxes erscheint. Gewif steigen die Nebel nur deshalb auf, damit der Akt niche durch Szenenwechsel unterbrochen werde; aber gerade indem Wagner einen Schleier gestaltet, der unseren Augen, jedoch nicht unserem Ohr und Herzen vor dem Jubel hangr, ist eine Keuschheit am Werk, die gerade dem Wagnerschen Verlangen nach einer steigenden Depotenzierung des Gesichtssinns gemaG der Steigerung der Musik besser als am Tristanende entspricht.
Dennoch ist der Ton auch hier schon fern und nachtsichtig geworden. GewiB und mit Bedeutung nicht allenthalben, Melot, Brangane und Kurwenal, auch Marke singen in einer anderen Weise. Brangane bleibt toricht und trivial, ohne zu ahnen, was geschieht, Melot, der Gegenspieler, wird zum kurzsichtig urteilenden Verrater, und nur Kurwenal und Marke, die beiden guten Menschen, srehen zuriickhaltend, demiitig geworden vor dem ganz und gar Undurchdringlichen, Kurwenal sogar ohne zu fragen oder die neugierige Frage des Hirten zu verstatten,
68
vor dem unerforschlich tief geheimnisvollen Grund, der Tristan zum Verbrecher macht und der sich selbst im Sehnsuchtsmotiv nur sehr unzureichend ausdriickt. Es ist ftihlbar, welch cin anderer Ton erklingt, wenn die Tagmenschen, diese bloden Wachen und Erwachsenen iiberhaupt, und wenn die beiden Nachtgeweihten sprechen. Weniger zuerst, wo es noch, zackig oder starr rhythmisiert, Isoldens Schmach und Tristans Ehre zu horen gibt; aber wie unendlich stark irn zweiten Akt: der Anker ist los, das Steuer ist dem Strom, den Winden Segel und Mast iibergeben, Welt, Macht, Ruhm, Glanz, Ehre, Ritterlidikcit, Freundschaft, alle Giiter des Tags sind wie wesenloser Traum zerstoben; es bereiter sich zur Fahrt in das geheimnisvol lste Land, und das grelle Tagmotiv, auf das Melot, der Verruchtc, zuerst singt, harmonisch dem: "Wer wagt mich zu hohncn>- des Anfangs verwandt, und das den zweiten Akt eroffnet, schneidet mit seinem jahen Intervall und seinem aufpeitschenden, harten, auch stark hervortretend plastisdien Rhythrnus fiihlbar in den langsamen Zug, in das iiberwiegend akkordische, rhythmisch zogernde Adagio der Nacht. Ja selbst in dieser eben hat man den zwingenden Eindruck, es gabe nicht cinmal solch stillste Art von Musik, wenn Isolde und Tristan sterben konnren, wenn sie nicht die Sehnsucht doch noch an diese Welt in jener bande, weswegen ja Wagner im ersten Entwurf den wandernden Parsifal, ein anderer, tieferer Heilssudicr, an das Sterbelager des todwunden Tristan gelangen lassen wollte. Noch losch das Licht nidit aus, noch ward's nicht Nacht im Haus: sonst ware nichts mehr zu vernehmen, aber der Drang, die Liebeslust, der sich ewig neu ausgebarende Wille. wenn auch nicht mehr der zur irdischen Fortpflanzung, nicht rnchr der Gattungswille, die krampfhafte Mutter, die nicht sterben will, was sie miiGte, damit das geistliche Kind leben kann, - SInd geblieben, und die alte ernste Weise des Hirten ertont sich zu sehnen, im Sterben sich zu sehnen, vor Sehnsucht nicht zu stcrben: nach Isolde, die noch irn Tag lebr, nach Tristan der in
~ . '
uern ReIch, vor dem er erschauert, Isolden nicht begegnen
konnte, weil ihn die Nacht dem Tag wieder zuwirfl, und so auch jene allertiefsre, aber irnmer noch irgendwie exoterische Musik wieder an unser Ohr dringt, die an dieser letzten Obergangsstelle wohnt. Das miiGte freilich nidu so sein, denn der
Ton hat keine Grenzen. Es ist sonderbar genug, da~ uns Tristan und Isolde iiberhaupt entschwinden konnen, da~ sie uns audi im Ton, bei so tiefer Zuriistung, nidus mehr zu sagen haben. Denn niemals sonst war die Musik so sehr dazu geschaffen, die ganze Nacht zu tragen, als einen Zustand und Begriff, wie er sich durch das ganze Werk hinzieht und die eigentliche Terminologie Tristans bildet. Aber so scheint es doch nur die Dammerung, Freilich eine weitabliegende, und nicht die Nacht zu sein, auf die sich die Tristanmusik, die immer noch irdischc, prozefshafle, bezieht. So fuhlbar auch hie und da das Ende des Wahns aufzulcuchten scheint: lautlose, buntschatrige Traume, ein geistliches Leben, der Liebestod, der Liebesraum, die Passio, wunderiiberschiittet, die lyrisch iiberdauernde, metadramatische Glorie, so unzulanglich zieht sich all dieses doch wieder in der wei ten und unscharfen Perspektive des Allgemeinen, der Liebe iiberhaupt und ahnlicher gestaltloser Zentren zuriick. Gewill, nicmals wurde das Ich griindlicher gcsprcngt und entschiedener zum Anderen iibcrgcfiihrt. »Du tratst aus meinem Traume, aus deinem trat ich hervor«: urn so in dem Anderen, ausgetauscht und mit seinem Bild im Herzen, die Lyrik der Fremdgefiihle, der im Anderen lebenden Selbstgefiihle zu gewinnen. Aber das eine Wesen: Und, das Tristans und Isoldes Liebe binder, vermag diese doch nicht zugleich zu distanzieren; es fiihrt die Seelen ineinander iiber, madit ihre Gesichter und Gestalten letzthin unkenntlich und trcibt derart, entsprechend der indisch-Schopenhauerschen Gegenstandslehre der Musik, alles Selbstische, Luziferische nur urn den Preis aus den Subjekten aus, da~ sich start dessen ~ in des Weltatems wehendem All, ertrinkcnd, versinkend, unbewullt ~ die heidnische, die subjektfrernde und asiatisdie Allgcmeinheit des Brahm ausbreitet. Deshalb bleibt auch der nachtsiditige Ton bei Wagner zulerzt mit leeren Handen stehen, deshalb geben uns Tristan und auch Parsifal zwar den vollen lvrischen Glanz, die volle, iiberdramatische Entbrennung des lyrischen Ichs, folglich die gegenstandliche, ontologische Erfiillung der Mozartsdien Marchenoper, ja sogar der Bachschen Passionen und ihrer dort adamitisch-christlich entbrannten Lyrismen; aber so durchdringend auch allenthalben bereits der still ere, tiefer diristliche Glanz des Adagio dariiber liegt: das, was hinter dem Prozef des Seh-
70
nens ist, die Ruhe, die vollige Seele, die Bachsche Fuge als musica sacra, das metaphysisdie Adagio, die Musik als »Raum .. , die Musik des parakletischen Ich, der architekronische Kontrapunkt oberster Ordnung, das alles bleibt wegen der zutiefst unchristlichen Mystik des Wagnerschen Allgemeinen und Oberhaupt unerreicht.
Wer einmal wahrhaft driiben war, kehrt nicht mehr heil zurlick. Er ist abgetrieben, als harte er Blut in den Schuhen, oder aber, je nachdem, er hat den langen Blick. Auch Tristan hat alles vergessen und ist vollig fremd geworden, in den fiinfhundcrttausend Jahren, da er in die Nacht geblickt hat. »Welcher Konig?« fragt er Kurwenal, der tiber Bord auf Marke deuten IllU~, als ob es [iir Tristan iiberhaupt jemals einen anderen Konig gegeben harte. "Bin ich in Kornwall? .. fragt er zuletzt, da er Kareol, die Burg seiner Vater, nicht rnehr erkennt. Und wiederum: ,,0 Konig, das kann ich dir nidit sagen, und was du fragst, das kannst du nie erfahren«: ja, als er jah erweckt, fassuncslos auf Melot und die eindringenden Manner starrend, die Worte Markes, seine eigene, unerrnefsbare Schmach und Todsunde langsam zu verstehen scheint, will sich Tristan doch kcin anderes Verstehen mehr zeigen als das des Mitleids und der zunehrnenden Trauer urn Marke. Fiir Tristan ist der Schein, worin die anderen leben, so unverstandlidi geworden wie diesen seine Nacht. Es sind Taggespenster, Morgentraume, tauschend, wiist und vollig sinn los in ihrer schneidenden Banalirat. Hicr brennt kein Licht mehr, das losen kann, mit Weite und chrornatisdi mythologischer Geschichte; der Erste, der ins Unsichtbare, Wahrhaftige ging, sah nidits, der Zweite wurde wahnsinnig, und Rabbi Akiba ist niernand als sich selbst begegnet; auch die Nacht, in der Tristan war, hat keinen Morgen mehr auf dieser Welt.
Aber cs gibt noch einen anderen Heiden und seinen Zug. Es gibt noch eine andere Sonne, nicht gegen, sondern hinter der Nacht zu finden. Zu ihr hin sind die vier Menschen im Parsifal voll anderer Sehnsucht unterwegs, Noch jetzt lebt Kundry m'irchenhaft als die verschlagen gutmiitige Frau des Menschenfressers oder auch Elternmurter des Teufels weiter. Noch jetzt hat uns das Mardien »Tisdilein deck dich .. den ganzen Gralsrnythus bewahrt, den diebischen Wirt, den Kniippel aus dem
71
Sack oder die heilige Lanze, den Esel Bricklebrit oder den Mondgral und das Tischlein deck dich, den eigentlichen, hochsten Sonnengral seiber. Man weif auch, daB Klingsor und Amfortas urspriinglich eine einzige Person, narnlich der Wolken damon waren, der das Licht verbirgt. Nicht ganz so deutlich ist Parsifal zu entwirren, der zuerst befruchtende und dann vollig entsagende Held. Er tritt schon [riihe an die Stelle Thors, des Gewittergotts, der den Gottern immer wieder den Sonnenkessel aus der Gewalt des Riesen Hymir entwenden muB, als welcher im Osten der Urgewasser wohnt. So ist auch Parsifal in den indischen und mittelalterlichen Sagen, die, worauf Schroder zuerst und mit Glilck aufmerksam machte, allesamt auf diese uralten Astralrnotive zuriickgehen, wesentlich der kesselraubende, gralsuchende, sonnenerobernde Held, der Meister des Regens und vor allem des Lichtzaubers geblieben. Nur das vdllig Reine, die Unschuld des Herzens ist als christlicher Zug hinzugekommen, aber sonst schimmert der urspriingliche Astralmythos immer noch so weit durch, daB Parsifal die Lanze entweder erst suchen muB, oder aber sogleich mit der Lanze als dem Gewitterinstrument den Wolkenriesen totet, urn den Mondtau als den Trank Soma oder das Nektar, vor allem aber den Lichtkrug, das Ambrosia, das heiBt eben den Gral mit der Sonnenspeise, die spatere Schale, in der Josef von Arirnathia das Sonnenblut, das Heilandsblut aufgefangen hat, zu gewinnen. Hier hat Wagner in allem verstarkt und verriefl, die Einweihung durch Liebe hinzubringend. Kundry, sUndig, verworren, doppellebig, vom Guten zum Schlechten durch einen totenahnlidien Schlaf getrennt, der Schof der Wollust und endlosen Geburt, ewig verlachend, ewig unglaubig, aber auch die heilende, kraurersudiende, demutsvollste Dienerin. Klingsor, der Dieb, der Zauberer des falschen Tags, Arnfortas, der Unterliegende, krank an seinem grenzenlos begehrlichen Herzen, ein ins Undenkliche, gesteigerter sterbenwollender Tristan, in seiner Weise Dieb, aber voll heiliger Begierde nach dem VerheiBenen, nach dem orphischen Erneuerer des Heilturns: Parsifal, arm, unerfahren, der reine Tor, durch Mitleid wissend der reine Tor, welthellsichtig, in dem das ungeheure Leid die Augen aufsdilagt, der den Drachen iiberwindet, dieses Symbol des Weibes und der Wiedergeburt, und nun, ein anderer, hoherer Sieg-
72
fried, nicht so sehr die Sprache der Vogel als das, was keine Sprache hat, das angstliche Harren der Kreatur nach der Offenbarung dcr Kinder Gottes versteht. Bei ihm ist das Keusche und Reine absolur geworden: Parsifal also ist nicht mehr der sich ubersdiwanglidi ergieBende Jiingling des Astralmythos, der die Wolken zerspaltet und rein naturhafle Frudrtbarkeir bringt, sondern umgekehrt, er verwandelt den Zaubergarten in cine Einode, und das Brachland irn Gralsgebiet wird mit einer durchaus anderen als der Tagessonne und einem durchaus tieferen Lichtanbruch als dem des blof naturhaflen Weltensornmers gesegnet. Jedoch immerhin: es geht von neuem der Sonne entgegen, der geheime Fuflpfad ist deutlich da, auf dem sie dic Berge ihres Aufgangs wiededindet. Was der Liebesnacht nicht gelang, ist der heiligen Nacht gelungen: auf dem Grund ihres Brunnens die sdione Wiese, das ratselvolle Licht des Karfreitagrnorgens zu gewinnen. Schon die auBere Helle veriaBt den Tag: "Wie die Sonne froh sich scheidet aus des Tages leerem Sdiein«, dichtet Wagners Freundin irn dritten der fiinf Gedichre mit sonderbarer Dialektik, zugleich nachtmystisch sein Zll konnen und doch das Tagesgestirn zu retten; und die Musik des Parsifal, wenigstens dort, wo sie nicht blofse Handlung ist, also der lrrnis und des Leidens Pfade dramatisch durchmiBt, sondern still wird und dem himmlischen Morgengliihen seine unbewegtc, metadrarnatische, ontologische Deutung zu schuld en sich berniiht: beim letzten Mittag, bei den Exequien, bei der zunchmenden Darnmerung in der Tiefe und dem wachsenden Liduschein aus der Hohe, bei der frommen, ratselhaflen Blasph ernie des: »Erlosung dem Erloser «, - diese ontologische Musik des Parsifal will nichts als in jenen innersten Tag in das WOrt »Seele« hineinfiihren, das nidit mehr von dieser und bum noch von jener Welt ist, kaum noch dem aonenhaftcn Lichtprunk der alten Throne, Herrschaften und Machte zugetan, Das ist ein Licht, von neuem iiber alle verhallenden Worte hinaus oder nur noch jenem einen Wort entgegen, das die Riegel sprengt, dem nichts so nahe kommen kann als das neue sich Vcrnehrnen und Eingedenken der Musik, das Hebbel in den unvcrgeBlichen Versen ahnte yom Tauben und vom Stummen, und Gott hat ihm ein Wort vertraut -
73
»das kann er nicht ergriinden, Nur einem darf er's verkiinden, Den er noch nie geschaut.
Dann wird der Stumme reden, Der Taube vernimmt das Wort, Er wird sie gleich entziffern,
Die dunkeln gottlichen Chiffren, Dann ziehn sie gen Morgen fort.
DaB sich die Beiden finden, Ihr Menschen betet vie!.
Wenn, die jetzt einsam wandern, Treffen, Einer den Andern,
1st aile Welt am Ziel.«
Freilich auch nur den fernsten Schein dieses Tages zu geben, mag vorlaufig noch weniger gelingen als die Musik der Nadu, Wenn auch der Ton im Parsifal durchaus nach oben weist, also das Allgemeine nicht so sehr in die breite, meerestiefe Mystik herabzieht wie im Tristan, so konnte er doch nidit sonnensichtig werden, so vermag hier doch die Musik noch weniger zu »sprechen« oder gar deutliche, nicht nur stimmungsmaliige, formal mythische, sondern inhaltliche, konstitutiv mythische Beriihrungen mit der oberen Welt zu geben. Und daB sie dieses nicht vermag, daB sie nicht ausspricht, sondern bestenfalls nur aufschlielit, daB das metaphysische Adagio immer noch bloiie, undeutlich feierliche Musiksphare bleibt ohne aIle Kategorien, erweist von neuem, in dieser aufsteigenden Polemik aus Bewunderung, aus dem MaB des Absoluten, wie weit Wagnersche Musik doch von dem letzten heiligen Stand, von der Erfiillung der Musik als Verkiindigung, als iiber aile Worte hinaus beginnender Losung unserer geheimen Natur, noch geschieden ist, die sie als erste nach Beethoven so tief betreten hat. Desgleichen laBt sich letzthin nicht verheimlichen, daB Wagners Werk auch andere Kreise gestreiA: hat, als sie musikhaA: tieferhin erwiinscht sein konnen. Wie ein verrufener Ring allen seinen Besitzern das gleiche Verderben bringt, so hat auch die allzu weitgehende Wiederaufnahme der alten hcidnisch-kulri-
74
schen Aktion, start der reinen Erfiillung des marchenhaflen Mozart, des diristlidien Bach, den iibrigen Wagner, vor allem den der Nibelungentrllogie, rettungslos dem Traum des blofien Naturwillens als Gegenstand ihrer Musik ausgeliefert.
Denn keiner handelt hier, wie er menschlich modue und konnte. Ist der Eine, so prahlerisch, ein Held? ist der Andere ein Gott? Sie sind beide nicht das, wofiir sie sich wortreich genug ausgeben. Siegfried leidet und folgt mit Gefiihl und possenhaftern Hornruf seinen unbedeutenden Trieben. Wotan ist schon buhnenmaliig durch sein eingeschlagenes Auge und den Larnpensdiirrn davor verhindert, ein Gott zu sein, und nichts Ubermiichtiges, Geheirnnisvolles ist an dieser langweiligen Gestalt. Das Geheimnis ist auf die Nornen und auf Erda zuriickgeschoben, und sein Walten wirkt nicht iiberzeugend. Hier drangt sich, wie wir sagten, der Ton fast vollig ins Leere und triibc;cwordene Tierische heriiber, Es gibt in diesem Werk keinen Durchblick, der anders aus der Enge der Person herausfiihren k ountc als dadurch, daf] er eine Welt von Pappe, Schminke und heiIloser Heldenpose auftut. Die [iihlenden und agierenden Menschen wurden allzumeist angemalte Marionetten, an dcnen sich das Vergewaltigende, Unwiirdige, Ichfremde, auEerlich Allgemeine und Abstrakre dieses Wahns abspielt. Das alles w irkt mit wallender, portierenhafter Aufmachung, mit totem Sprcchgesang, endloser, pathetisch langweiliger, iiberfliissiger Konversation, mit peinlichen Jordanschen und Felix Dahnschen Rcminiszenzen und einer Lyrik, die trotz vieler herrlicher und seelcnvoIler Einzelheiten, wie man sie nur gerne am anderen On schen mochtc, das Gequalte, lange Liegengebliebene und dann wieder Aufgenommene, das Kiinstliche, GelehrtenhaA:e und nur mit der Lampe Zusammengeschweiflre dieses Sagenwcrkcs nicht vergessen machen kann. Gewif ist hier der Ton an sich unvergleichlich viel reiner als das Neue, das dann aus Ton und Wort, aus dem sich allzu selbstgerecht vordrangenden und doch bei keiner Auffiihrung verstehbaren Wort gemischt hat. Wagner erfindet nicht nur viele Einzelheiten, ja ganze GeItalten aus dem Klang - man denke an Loge, der mit dem flaej,_ern iiberhaupt erst anhebt, oder an das uns unheimlich mit versinken lassende Vergessenheitsmotiv, oder an die diistere GroBe und Einsamkeit, an die wahrhaA:e Endes- und To-
75
desmusik in Brilnhildens Schlu6gesang -, sondern der Meister entdeckr auch in seinem quer durch die Bewuiltseinswelt und noch quer unter die Bewufsrseinswelt gelegten Orchester wesentliche Bewegungs- und Begrilndungsmittel, also Leitrnotive irn mehrdeutigen Wortsinn, die das wachende Textbuch nicht enthalten kann. So ist gewif hier oflmals ein hellseherisch vorauseilendes Tun am Werk, das die namen- und begriffslose Darnmerung der agierenden Willensmachte sehr wohl in der gewaltigen unteren und oberen Bewufstseinsausdehnung, in der Mehrstockigkeit melismatischer Polyphonie zu erhellen vermag, nachdem die Willensantriebe in ihren Verkettungen fast nicrnals in das vollstandigere Bewufltscin der oberen Stirn me, also in das ausgesprochene Motivieren der Menschen fallen konnen. Aber das alles hebr blofles Gerriebensein nicht auf, und der Ton schlagr so ofl: in seinen halbmilirarischen Tamtamschlag oder auch in sein weites, niedrig, niederstehend allgemeines Espressivo zuriick, als sich nur ein schicklicher Ort filr diese sonderbar subjektive Tierlyrik auffinden la6t. Man sieht, der Klang erzeugt hier bei allem weitraumigen Toben nur Leidenschafl:, aber keine echte Handlung, und noch weniger personlich zwingendes, metaphysisch bedeutsames Schicksal. Es ist zufallig, da6 mit Briinhilde dieses und mit Siegfried jenes vorgeht, ihr Schicksal ist traurig, aber nicht norwendig, nicht tragisch, und die Gotter, die es verhangen, werden Gorter genannt, ohne es zu sein. Wie man mit Recht bemerkte, daB die Wagnerschen Liebesheldinnen nie Miitter werden, die eine Sieglinde ausgenomrnen, und selbst die nur, damit sich der briinstige Liebesglanz ohne weitere Korrektur bei Brunhilde und Siegfried wiederhole, so hat auch das Ganze - trotz aller Breite, trotzdem hier Menschen und Gorter sich begegnen, trotz aller letzten Weichheit, phantastisch beseelten Natur, Riesenhafligkeit der Geschicke, Eschatologismen des Hintergrunds, des Ragnarok - doch kein Gesicht, keine Fortsetzung nach vorne hin und nach oben hinauf, keine edite Handlung dramatischer oder gar meradrarnatischer Art. Das ist insgesamt und durchaus Untermenschliches und kann seine magischen Springwurzeln nur benutzen, urn start der Erlosung eine hilflose, rein naturhafle Narkose aufzuschlie6en und - start des weitgebausch ten menschlichen Herzens, statt des endlich erklarten,
76
als Musik erklarten, dauernd bei den Menschen wohnenden Barocks - unterirdische Falltiiren, Allgemeinheiten, Verratereien und Naturmythen zu installieren. Das ist nicht wahr und bleibt »Kunst« im schlechten Sinn, ohne geschichtsphilosophischen und mctaphysischen Ort; dekadente Barbaren und dekadente Gorter sind hier drarnatis personae, und nicht die Sehnsucht nach Siegfried, dem germanischen Messias, nicht der ferne, lctzte, von ontologischer Musik beschworene Gott der Apokalypse und des apokalyptischen »Gnadendramas«.
So ist hier alles bewufste Wollen aufgegeben, ohne ein anderes ins Neue hin zu gewinnen. Es rauscht, es blitzt, der Nebel spricht und sprichr doch nidit, denn alles schwimmtzusammen, und das abgemachte Wort redet drein. Es ist aber zu gewinnen, das andere Wollen, ballt sich erst die Faust, die die innere Tiir erciffnct, wo nicht gar einschlagt, Beethoven war auf diesem Weg, mit mannlicher, tapferer, sittlidi gegenstandlidier Krafl, und diese allein kann wieder mystisdi, erlaubt mystisch machen. Audi Wagner wollte derart lidirhafl sein, aber dazu lie6 er nun nicht etwa seinen schwillen Ton zu Ende reden, damit dieser die ihm eingeboren seelische Sprache finde; sondern eben, cr iiberkompensierte das Triibe auf scheinbarste Weise durch die Verstandigkeit des Worts. Freilich kam so auch poetisdi nicht das gelichrere Wort heraus; der tonale Dunst wurde nur noch schwiilcr gepre6t, und die dagegen au6erlich, sentimentalisch ergriffene Glucksche und klassizistische Klarung geriet, dem dauernd iiberwogenden, unbeendeten Ton entsprechend, lediglich zum Ausdruck »v erworrener Vorstellung« inadaquater Brunst. Wagner wollte hier nidit warren, bis sein eigenstes, d as Tonwort, seiber kam, aber gerade der begnadete Musiker mu6 lctzthin imstande sein, vollig losgelost, absolut zu bleiben und zu sehen, wohin ihn seine nur erst halb gekannte, nur durch Konscquenz erforschbare Kunst fiihrr, in welches unerme6lich r nnere seines Reiches ihn die radikale Expression bringt: ohne jeden Einflu6 des Poetischen, als welches vielmehr auch in der transzendenten Oper nur eine Variable sein darf und am Schlusse sogar jedes Korrelat vor dem iibcrrationalen anderen Korrelar der Musik verliert. Sonst zerrt sich alles so weit herunter, da6 wir iiberhaupt nicht mehr in Betracht kommen und ,dlein noch der unbewulite, pathologische Wille regiert. Der
77
eingeengte Ton radit sich, indern er sich zuriickstaut, indem er
in seiner ersten manadischen, chthonischen, unterlichthaflen start iiberlidithaflen und eingedenkenden Warme hypertrophiert und derart, nadidem hier die nicht zu Ende redenlassende Poesie vorgelagert ist, die dramatisdien Menschen in eine Region zuriickverlegt, wo sie nur mehr Bliiten an einem Baum sein konnen, der der Baum der Seele ist, ja sogar nur tanzende Sehiffe, die widerstandslos das Leid, den Kampf, die Liebe und Erlosungssehnsucht ihres unrerrnenschlidicn Meeres mitmachen und iiber die in jedern entscheidenden Augenblick, start der Begegnung aneinander und der eigenen Schicksalstiefe, nur die Weltwoge des Schopenhauerschen Willens hinweggeht. Gewif leisten die Einzelseelen einen bestimrnten Widerstand, aber nicht den des principium individuationis, sondern mehr den dienstbaren Anhalt, wic er zur Versinnlichung in Biihnenhaftigkeit schlcchthin, auch undrarnatisch, notwendig ist. Das ist nicht das neue einsame Ich, das nur von sich reden kann und es den anderen freistellen muf], ob sie sich darin finden, noch auch das Ich des Volkslieds oder Minnesangs, das von dem Liebenden, dem Alternden schlechthin als einem kollektiven Typus spricht, Ja, die Einzelseelen konnen nichr einmal mehr als blo-
~e Schauplatze betrachtet werden, auf denen die abstrakten, aber doch noch auf die Menschen zuriickweisenden Machte der Sinnlichkeit und Vernunfl: ihre Kampfe ausfechren, sondern die unteren Spalten sind geoffnet, das Untere tritt an die Stelle des Oberen, das Meer tritt die Erbschafl: des Himmels an, und das
Ich schlagt sich, hie und da so gar in den Meistersingern, derart
in Drang, Wahn und Gliihwurmgleichnis, in johannisnadit, Johannistag und Unbewufstsein iiberhaupt, in Wogen, Darnpfgewolk und niedrigen Hodischlaf zuriick, daf es nicht mehr )~ aus sich und erst redir nicht aus dem Beethoven-Comteschen i!1
Grdand errde als der dsoziaIBm~~tisdmen IEntitat der Mensmheiti.:t ..• · .• re et, son ern aus em aucn es a ten Naturgottes, wenn 11
audi durchaus ohne dessen sidcrische Klarheit und alte Plasti_IC sche Mathematik. Darnit ist cine willenlose Hingabe an die • . Stelle des krafl:igen Einstehens, der Harte, Strenge, des Siin- .•.
denbewuflrseins und der streng individuellen Postulate des ;:.' .•. diristlichen Glaubens gesetzt. Es ist alles hcidnisch, was die ~,gnmm' Nibelungenrnusik, diese sonderbar mit Schmutz, I
i
";
Gold und Narkose durchwachsene Musik, an Breite, Falsdier Entriickung und anonymer Glorie zum Dienst ihres diristlidi erschiitterten, aber nidit diristlidi gesprengten Naturprinzips bcreitgestellt hat. Daf es so gekommen ist und daB die Aufzeigung des Objekts der transzendenten Oper, an ihrem gefahrlichsten und wenigsten gclungenen Typus gemessen, so iiberraschend ins iiberhirzt Unwesentlidie und zutiefst Undramatische geht, liegt also, immer wieder ersidulich, durchaus nicht nur an der nach dem Falschen Gegenstand hin bewegten, dionysischen Tanzrhythmik, sondern eben zuletzt auch an der Lagerung eines schon ausgemacht Poetischen iiber der Musik, sofern dieses die Tonkrafle herunterdriicken wollte und die abgesctzte, aber im Wagnersmen Genie unabsetzbare Musik dazu zwang, sich irn einzig belassenen Unbewufsren mit solch voller, ihr eingeborenen Absolutheir auszubreiten, daB ihr die Augen und das nom nichr Bewullte, Uberbewulire, das heroism-mystische Phantom Mensch und die wahrhafl:e Unendlichkeit des innerlich Wirklimen und Ontologischen verloren gehen. Freilich. es gibt Forderungen, die geschichtlich, dem Stand der oberen Uhr nach, nicht erfiillbar sind. Aber Wagner hat sich zu c.nern gewissen Teil urn seine Stunde gebracht, die eine grofle und heilige Stun de war, und in der die ungeheuren Impulse seines Tristan- und Parsifalmysteriums wirksam wurden. Was der art nicht erreicht worden ist, das sind jene immer noch aussrchenden Erfiillungen der Bachschen ontologischen Lyrik und cler Fuge, des Bachschen melismatischen-kontrapunktischen G leichgewichrs, das Zie! der Reinigung, der schlichthinnigen Gegenwart, der unzerblatterren Rose der jungfrau, des unzerrisscncn Herzens des Sohns, der Dberwindung jedes Agens zum Raum und der Heimkehr miider, namenloser Kaspar-HauserNatur in den Thronsaal ihrer himrnlischen Herrlichkeit. InsoInn kann man sagen, hat Wagner allerdings von der luzifeflschen Zielrichtung des Selbst abgelenkt, wie sie seit Beethoven der Musik eingeboren ist; und der Wagnersche Tongang, der geborenc Erheller der oberen Reiche der Seele, isr dort mit auf Grund der erzfalschen indisch-Schopenhauerschen Musikdefiniriol! ins Verblendende und vergiflet-pathologisch Mysterische umgeschlagen, wo bei volliger Freiheit und Konsequenz gegensrandlicher Musik das keimende Zungenreden, also das luzi-
79
ferisch-parakletische Wollen des menschenhaften Musikgeistes selber vom Geheimnis harte verkiindigen konnen, yom Geheimnis des intelligiblen Reichs. Doch ebenso ware ohne den Vorangang Wagners die Vermissung, die auf diese Reiche als Tonreiche bringt, gar nicht angelauter: Tristan ist ihr Anfang, das Celeste im Parsifal ihr Besprechen.
Darnit ist eine lange Reihe zu Ende. Sie hat unerrneiilidi HerrIiches gebracht, und doch bleibt das bittere Gefiihl, das Mozart, Schubert und Beethoven vor dem Srerben qualte: - namlich, dag es ihnen sci, als ob sie jetzt erst anfangen miigten, als ob sie noch keine Note geschrieben hatten - auch fiir den Begriff in Kraft, nur mit dem Unterschied, dag sich die Bitterkeit in Jubel und Hoffnung verwandelt. Der Ton »spricht- noch nidrt, er ist iiberdeutlich genug, aber noch kann ihn niemand ganz verstehen, er ist ein heiges Stammeln, wie bei einem Kind, und die supponierende, von sich aus vorschreibende oder auch nur auffallende »Poesie- start mindestens im Musikdrama sowohl den Ton wie sich seiber, ihre eigene, eben falls untergeordnete, ja erschlagene Potenz. Fertig sind nur die Teppiche, diese Stakes und Zukunflskorrektive, und dann, minus der Bachschen Fuge, ihre Fiillung-Erfiillung in immer konkrererer Sphare, wahrend gerade die durch Wagner zur hochstcn expressiven Bestimmtheit erzogene Syrnphonie noch irnmer auf ihren durch sie selbst absolut musikalisch geborenen Gegenstand wartet, eben auf die angelangte Bachsche Musik, auf die Musik des Raums, des melismatisch-kontrapunktischen Gleichgewichts jenseits aller akkordisch-polyphonen Drarnarik, auf die Musik der vollig durchchristeten Seele und ihrer wahren klanglichen Grundfigur. Zu hoffen bleibt vieles, und eine grofle Situation wird reif; die Tage stehen vor der Tiir, in denen sich das bestan dig zuquellende innere Leben, der Durchbruch und die Ahndung allemachster, allerlerzter Latenz, iiberhaupt nicht mehr anders als im Musikalischen, Ethischen und Metaphysischen ausdriicken kann, wobei auch nicht mehr langer notwendig sein wird, sich bei dem Satze des Areopagiten: das gottliche Dunkel sei das unzugangliche Licht, in dem Gott wohnt, als der obersten Fassung aller assoziativen wie transzendentalen Faktoren der Kunst zu bescheiden.
80
ZUR THEORIE DER MUSIK Wir horen aber nur uns seIber.
E5 1St und bleibt zwar schwach genug. Zu vielen fiele das Horen dann erst leichter, wenn man wiifitc, wie man dariiber zu reden hat. Das hangt mit dem hochsr unsicheren und abgeleitcrcn Fiihlen der Menschen zusammen. Denn diese sind so beschaffen, daB sie sich durchaus nur auf dem Boden der Mitteilung zu Hause wissen. Sie miisscn Mittel haben, sich ihr Piihlen zurechtzulegen, sofern dadurch eben cine weitaus geringere Teilnahme, cin wei taus geringerer personlicher Einsatz erforderlich wird, und zudem das fehlende Verstandnis eingetauscht, ausgctauscht oder abstrakr ersetzt werden kann. Ware es nicht so, dann ware auch das musikalische Zuhoren weniger zerstreut und nerves. Dann wiirde sich die Frage, weshalb gerade die zu sp,it Gekommenen vorzliglich dazu geeignet sind, aile Aufmerksamkeir in einem Konzert auf sich zu ziehen, weder stellen 110ch gar in einer fiir die davon Betroffenen so peinlichen Weise beantworten lassen. Dann lieBe sich vor allem bei den p'oGcn natiirlichen Neigungen, die jeder Mensch zur Musik mitbringt, schwer faBlich machen, warum die erklarte Liebe zu diCIer Kunst gerade in der geistigen Hautevolee so seltcn anzLltreffcn ist. Die mittleren Burger leben mit der Musik, weil sic die Gemiitlichkeit Iieben und die Konzertberichte lesen, wogcgen ihnen umgekehrt die Malerei mit ihren schwer zuganglichen Begriffen recht entlegen und wie ein Feld erscheint, in dcrn man unwillkiirlich Fehler schiefit, Es gab jedoch Zeiten, wo (" auch fiir die geistige Oberschicht der Malerei vis-a-vis so s'.~lnd, bis endlich Winckelmann und neuerdings Riegl den fat.i i cn Bann der eigenen Teilnahmslosigkeit und Entscheidungs"hw:lchc auf logischen Umwegen gebrochen haben. Das Horvnk onnen ist und bleibt dagegen nuch schwach genug. Denn musikalisdi gibt es leider keine alten Winckelmanns und die neucn hei&n Leopold Schmidt. Selbst der eine August Halm .narlit bei aller Vielseitigkeit noch keinen Summer. Paul Bekker isr ein kluger Mann, aber er laBt es uns sehr oft vergessen, ur.d scin mardiencrzahlcndes Beethovenbuch ist nicht durchgel~ends eine Ehre. Grunsky, auch Hausegger sind zu empfehlen, auflerordentlich widitig ist auch - sehr aufserhalb dieser Reihe
81
- die Schrift Richard Wagners tiber Beethoven; aber zu Riemann wird man greifen, urn tiber alles Theoretische ausgiebig belehrt zu werden, freilich leisten dafiir Moritz Hauptmanns profunde Werke noch grUndlichere Dienste. Die Opernfrage ist neuerdings vor allem durch Busoni, kritisch anregend auch dunn Pfitzner wiederum zur Diskussion gestellt worden. August Halm seiber, dem wir manches verdanken und den eine grofle und gebildete Scharf'e auszeichnet, ist darin bedenklich, daB er allzusehr nur handwerklich wertet, allzu buchstablich kritisiert und allzu durchgehends nur nach gut erfundenen Themen und ihrer dynamischen Bewegung analysiert. Auch laBt sein Ton Beethoven gegentiber manches zu wtinschen iibrig. Dabei gelingen ihm freilich so bedeutsame und notwendige Leistungen wie die kritische Analyse des ersten Satzes der Beethovenschen d-moll-Sonate; aber er kennt und anerkennt nicht das naive, formkritisch unzugangliche, expressive Musizieren, das einen Menschen und nicht eine Werkform widerspiegelt und das wohl anders lauten kann als die Bekkersche psychodramatische Auslegung. Selbst das ewige Leben wird hier nur zu einer Welt von strengeren und hoheren Gesetzen, in Halms allzu we it gespanntern Formbegriff von Musikhaftem iiberhaupt, der durch ein angehangtes Spittelerisches M ythologisieren nicht deutlicher oder tiefer wird. Trotzdem ist sehr zu hoffen, daB sich auch die intellektuellen Menschen bereitwilliger zum GenuB der Musik aufmuntern lassen, sobald ihnen nur erst einmal feste, sachlidi weiterleitende Begriffe an die lenkbare Hand gegeben worden sind.
Der Gebrauch und die Tondichtung
Der Tonfall Nur miissen wir uns dabei seiber bring en.
Dann fassen wir sogleich, was uns gerufen wird. Der Blick, aber vielmehr noch der Tonfall sind an sich deutlich ohne Urnwege. Wir fuhlen, das sind wir; es handelt von uns, auch wir wiirden so rufen oder uns so verhalten. Der eigene, stets leise mitinnervierte Kehlkopf laBt uns das, was uns hier zugerufen wird und spricht, gleichsam von innen her sehen und verstehen.
82
Dazu kommt, daB wir uns auch in nichts besser zu au Bern wissen als im Tonfall. Der geht tief, und wo der Blick vergroberre und zuriickweichen lieBe, wo das Schweigen beredter wird als das Sprechen, verstarkt erst recht der Gesang noch die leiseste und unfaBbarste Regung. Er lost gleichsam den Tonfall als das Fliichtigste und doch Krafligste, urn intuitiv sein zu konnen, von den Menschen ab und sammelt ihn zum forlaufenden, verdichteten Gebilde. So vieles kommt hier also auf den von uns angeschlagenen Ton an. Es ist wichtiger, was in ihm vom Singenden selber umgeht, was also der Sanger oder Spieler in den Ton -hineinlegt«, als was sein Gesang rein tonal enthalt, Denn dieses an sich setzt nur eine ganz allgemeine, dem Belicben des Gebrauchenden weitgehend unterworfene Stirnrnung.
Der Anschlag
AlIzu wenig wiirde sich ohne dieses klaren. Es bleibt ausschlaggebend, den zu sehen, der hier musikalisch ruft oder anschlagt.
Darum eben laBt sich dassel be auch so sehr verschieden singen. Man weiB, wie oft ein Lied seinen Herrn gewechselt hat, ohne daf1 irgendeinem Horer das meist Ungeheuerliche dieser VeranJerung bewuBt wurde. Wie lieBen sich sonst auch die verschiedenartigsten Strophen melodisch gleichartig vertonen? Man sucht dies zwar jetzt zu vermeiden, aber auch der Schubertsche »Lindcnbaum- hat solchen Fehler, also kann er nicht ganz unbedingr sinnstorend sein. Oberdies, wer kann hier nur noch formanalytisch sein wollen, wenn er erfahrt, daB es dieselbe Melodie ist, die zuerst dem Volkslied: »Mein Gemtit ist mir vcrwirrt, das macht ein J ungfrau zart« zugrunde lag, die sich dann sparer dem Text: »Herzlich tut mich verlangen nadi eincrn sel'gen End .. verbunden hat, urn zuletzt noch heute in der Melodic des Chorals: ,,0 Haupt voll Blut und Wunden« fortzlIleben? Dasselbe b-fis-g, das in Susannens Sdilufsarie fur »sehnsuchtsvoll« steht, begleitet in der Ansprache Pogners, ohne irgendwie rhythmisch verschoben zu sein, den Glanz des Johannistags, mithin ein volliges jubelndes Erfiilltsein, ohne daB sich das Eine in Ansehung des intendierten Inhalts dem Anderen vorziehen lieBe. Man mag zwar einwenden, daB sol-
83
ches nicht beim gleichen Meister geschieht. Aud. daB Mozart gernaf seiner halb italienischen Eigenart kein vollkommenes Muster sinngemafser Zuordnung darstellte. Aber dafiir ist Bach ein durchaus deutscher Meister und der reichste, ausdruckskraftigste Melodienbildner iiberdies. Trotzdem zeigt sich nun bei diesem, also gerade in einem einheitlichen Gesamtwerk, derselbe Gesang, dcr in der 179. Kantate Heuchelei untermalt, im Kyrie der G-Dur-Messe als Flehen urn Erbarrnung verwcndet, und diesclbe Arie, die in dem drarnma per musica: »Die Wahl des Herkules« Wollust und ihre Abwehr (»Ich will dich nicht horen, ich will dich nicht wissen, verworfene Wollust, ich kenne dich nicht«) ausdriickt, im Weihnachtsoratorium einem Wiegenlied der Maria untergelegt. Wobei sich die Abweisung der Versuchung, nur eine Terz tiefer gelegt und auBer den Streichinstrumenten der opernhaften Fassung auch noch von Holzbias ern und der Orgel begleitet, aber sonst in nichts transponiert, zum eifrigsten Ratsdilag (»Bereite dich, Zion, mit zarrlichen Trieben, den Schonsten, den Liebsten bald bei dir zu schen«) verwandclt. Indem es jedoch anders gesungen wird, ist merklich auch ein anderes, dem »Sinn- fiigsames Bedeuten darin, und so wenig man bei dem Wort: beten an das Ben oder den Beton oder den Bettler denkt und beim Kiister an die Kiiste, gernaf dem leeren Oberraschungsmoment des Kalauers, so wenig braudit selbst bei einer rascher aufeinanderfolgenden Kenntnisnahme der fraglichen Stellen die melodische Identitat bei diesem Bedeutungswandel bewulit zu werden. Es will dcmgegeniibcr wcnig bedeuten, daB der deklarnicrte Gesang, wenn er gut ist, wie fast stets bei Wagner, eine gewisse, natiirliche stets identische Doppelgangerei zu den Sprechintervallen, Sinnintervallen betreibt, oder daB einzelne melismatische Wendungen der absoluten Musik, vor allern absteigende Seufzermotive oder Sehnsuchtsmotive mit dem Vorhalt, gewisse liberal! vorkommende, inhaltlidi identische Bedeutungen besrtzen.
So haben wir es durchgehends nur von uns her und nicht aus dem Tonschritt, was dieser bedeutet, Wird nicht vorgetragen, so bleibt das Klingen blind. Zwar der Sprechgesang lebt das Klangleben des gesprodienen Wortes getreulich mit. Aber er ist doch nur von oben nach unten gesehen verstandlich, und auch
84
das ausgefuhrteste Rezitariv konnte nicht von seIber darauf bringen, welches Wetter jeweils in den oberen textlichen Re,,;oncn hcrrscht, Nicht anders, ja noch viel ungiinstiger steht es mit der Sprache des melismatischen Bewegtseins in der begleitenden und absoluten Musik. Der Ton geht etwa in die Hohe und sinkt wieder zuriick, mit kurzem Atem, ein scheinbar klarer und doch ebenfalls mehrdeutiger Fall. Er kann einmal bedeuton, daB wirklich Resignation darin steckt, wie etwa in der wunderschonen Begleitfigur zu den Worten des Sachs: »Schon Dank, mein Jung« nach dern Wahnmonolog; aber er kann auch bcdcuten, daB der Tongang ladet und sich nun, oben angelangt, umwendet und die Oberfiille ausschiittet, wie in der jubelnden StrauBschen Begleitmelodie: »Und die belohnende Lust« aus dcm Schillerschen »Hyrnnus«, und nichts isr dabei objektiv vcrsrhiedcn als eine gewisse, an sich ganz unbcstimmte Breite des intcrvallhaften Rahmens, in welchem Aufschwung und raketcnartige Riickkehr geschehen. Man kann nun freilich wiedcrum cntgegnen, die beiden hier angezogenen, verwandten Bcispicle seien melodisch nicht sehr pragnanr; aber wo sie das sind, wird der erquickte Spieler, das innere Klavichord noch viel widrtiger, und seine cigenen Klage- oder Jubelbewegungen sind den gegebenen Tonschriftcn oft sogar gegenlaufig, unproportional entgegengesetzt. Oft ist das Sinken iiberhaupt ganz hleichgiiltig Fdr die Stirnmung, wie im Adagio des 5. Beethovcnschen Klavierkonzerrs, wo der Ton zweimal hintereinanclcr durch dritthalb Ok taven hindurch fallr, und start der Melancholie des Notenbilds lediglich eine gewissc Ruhe und Sicherheit des Zielens und Auftreffens innerviert. Oft auch, wie in dcm Motiv: »Huldreichster Tag« aus den Meistersingern, das mit einem kleinen Widerhaken in der Mitte genau die Dreiklangoktave hinunrerfallr, ist der Ausdruck dem Fall gen au kontrar gerichtet: und wenn hier auch in der Ouvertiire das aufsteigende Marschthema der Horner das in den Violinen niedcrgehende Jubelthema vom »Huldreidisten Tag« tibergreift, so ist es wahrhaftig nicht diese, im Orchester geschehende Gegenbewegung, die tiber Gliick und Ungliick in der Musik entscheidet. Zwar was die weiteren Deutungen angeht, so ist es moglidi, daB davon manches den Gebrauch unterstiitzt, konventionell unrerstiitzt, Sei es, daf sie einfach den Ton ma-
85
len lassen: dann sind die tiefen Tone jederzeit dunkel, schwer, lastend, massig, die hohen Tone jederzeit hell, leicht, luflig, auch iiberirdisch, Engel, Sternenwelt, dann ist auBerdem das dynamisch Schwache an sich korperlos, schattenhafl, gespenstisch, das dynamisch Starke an sich gewaltig, riesenhafl, ungeheuer, und zu alldem treten noch die mehr oder rninder bewegten, flieBenden, stiirmenden, zackigen, ehernen Rhythrnen hinzu, Sei es auch, daB die Deutungen noch griindlicher werden und der Tonreihe eine gewisse wertbetonte Entwicklungsgeschichte nach oben hin andichten, wonach die absteigende Bewegung in den BaB das Aufhoren und bcginnende Verklingen darstellt, wahrend, wie dies Kostlin ernst haft in Vischers .i\sthetik ausgefiihrt hat, die aufsteigende als eigentlich tonerzeugende Bewegung das Lebendige, Sdiopferische an der Musik, die Herauspressung des Klangs aus der an sich stummen Materie vor Augen fiihrt. Aber fiir diesen Naturalismus gilt dassel be, was [iir den Sprechgesang galt: daB cs ohne den vorherigen menschlichen Gebrauch keine solche Zuordnung gabe, und daB auch die analogste Gestaltqualitat nicht von seiber darauf bringen konnte, welche Geister sich jeweils in deren oberen logischen Regionen verbergen.
So macht auch hier allein der Anschlag, der Vortrag des Redners Gliick, ein Redner zu sein, der Klang will sich nach dem Menschen wenden. Oberall wird es wichtig, auf den Ausdruck zu achten, den erst das Gesungenwerden, der Strich der Violinen, der Anschlag auf dem Klavier, vor allem aber jener schopferische Gebrauch dem Notenbild hinzufiigen, ohne den weder Dynarnik noch Rhythrnus in ihrer vom Komponisten gemeinten Weise anschlagbar ware. Dieser Anschlag faBt sich zusammen im Dirigieren: und zwar so, daB es sich zunachst aus Klangzauber, Tonstarke, Steigerung, Temponahme, stimmungsmaflig kolorierendem oder auch zeichnerisch gestaltendem Kontrapunkt als den einzelnen Elementen des mitgeteilten Willens verbindet. Jedoch das Dirigieren enthalt auch ein Anderes, das die urspriingliche Vision des Schopfers wiederfindet, wie sie in dem »Werk" als ihrer nur ungefahren Andeutung und bloBen Chitfer der Verwirklichung vorliegt. Es ist die Kraft des geborenen Dirigenten (irn Gegensatz zu den Zopfen, die leblos, traditionshafl, aber ganz eigentlich respektlos
86
spiden, wie es dasteht, freilich auch im Gegensatz zu den sub[ektivcn Schwindlern, die das fremde Werk zum Aphrodisiakum ihrer sonstigen Unproduktivitat erniedrigen) -, es ist die Kraft des geborenen Dirigenten, so lange suggestibel zu bleiben, bis es sich plOtzlich von seiber spielt, bis das Wunder der Verwandlung, das Herren- und Gnadengefiihl des Geniedurchgangs in ihnen geschehen ist, und die Luft urn sie herum, die Werkluft, der Gebrauch und die Seele des Werks beerhovenisch aufgliiht und verbindet. Dann ist die geheimnisvolle Stelle erreidit, wo sich die toten Teile des Melisma und auch der Harmonie und des Kontrapunkts wieder zur urspriinglichen Vision zusammcnfiigen, und Bach oder Beethoven, also nicht dieser oder jener scheinbare Typismus der Zuordnung, sondern die getrotfenen Meister seiber als wesentliche Chitfern und Gegcnstande zugleich verstandlich werden. Man wird so ersichtlich am Ende starker noch als zuvor an den Tonfall, die Sprechweise und tonende Gebarde des Ausiibenden verwiesen, die als solche allein imstande isr, die nur schwache atfektive oder sonst wie signifikante Bestirnmtheit der geformt gegebenen Elemente oder analog aufzeigbaren Typismen zu verstarken, Nirgends scheint es so sehr notwendig, das seiber Mitmachen und im weircren den guten Interpreten zu fordern, der nicht nur alles zerstoren oder retten kann, sondern dessen rezeptiv spontane Zwischenform auch den eigenen Erlebnisdiarakter der Musik, dieses nur Ungefahre, begritflich Unfixierbare und dauernd Prozessuale des musikalischen Gegenstands unterstreicht und ()tfnet.
Denn es ist noch leer und ungewiB, was tonhaft geschieht. Auch mit dem Zuordnen zu bereits genauen Gefiihlen steht es musikalisch schlecht. Nicht einmal ob cine Melodie eindeutig Zorn, Sehnsucht, Liebe iiberhaup: ausdriicken kann, das heiBt, ob es diese unsere bestimmtcn, schon sowieso erlcbrcn Gefiihlsinhalte sind, auf die die Musik zielt und worin sie eine Statue leichthin i..ibertretfen konnte, laBt sich bei dem Ineinanderschleifen ihrer Erschiitterungen jedesmal genau unterscheiden. Es liegt an einern Anderen als am Klang, wenn die Horner nach Jagern, die Trompeten nach Konigen klingen, ja sogar wenn gewisse Rhythmen hier leicht beschwingt, dort im driickenden Grave, Humor oder Majestat oder ahnlidie, von .i\uBerlichem asso-
87
ziierte, ihr unterregionale Kategorien in die Musik hereinbringen. Der Ton ist weder einzeln, denn dafiir ist er gleichsam zu hurenhafl ; von der Poesie aus gesehen, was aber reflexiv ist, und der gegeniiber er keinen Ehrgeiz hat, nicht hurenhafl zu sein; noch ist der Ton wieder einfach nur allgemein, denn dafiir ist er wieder zu stark, zu unabstrakt, zu er-greifend, zu ontologisch geladen; es wogt, »aus lufligen Tonen quillt ein Weignichtwie«, alles fordert hier nur erst im Ungefahren. Und zwar deshalb, weil sich in der Musik, die jeder versteht, ohne zu wissen, was sie bedeutet, noch kein eigenes, zum Greifen klares Leben geregt hat, das irnstande ware, bereits ganz genau bestimrnte Kategorien statt des sogleich zu besprechenden dramatischen Zwangs, rnithin statt des blofien Umrisses symphonischer Dramatik und aufsteigender Idispharen zu geben. Sieht man ein Tonstuck von der technischen Seite an, so stimmt alles und besagt nichts, wie bei einer algebraischen Gleichung; sieht man es aber von dcr poetisdien Seite, so sagt es alles und bestimmt nichts - ein sonderbarer Zwiespalt, dem, bei so garendem Inhalt, noch jede Mitte und jeder dem Verstand zugangliche Ausgleich Fehlt. Hier niitzt es nidits, sich an das Technische zu halten, das tot und Schablone bleibt, wenn man es nichr durch seinen Schopfer interpretiert; und es niitzt auch nidits, sich an das Poetische zu halten, urn das »unendlidi verschwimmende Wesen der Musik«, wie Wagner sagt, zu Kategoricn zu zwingen, die nicht seine Kategorien sind. Hier hilfl nur, gut zuzuhoren und ahnungsvoll zu erwarten, was sich in der Musik, diesem Glockengelaute herab vorn vdllig unsiditbaren Turrn, noch alles an Sprache und hochster, sowohl iibcrformaler wie auch iiberprogrammatischer Bestimmtheit bilden mag. Schon Beethoven ist eine Faust und seiner Kunst fehlt nicht der deutlichste moralische Wille, das ist der moralische Wille sui generis, zustandig zur Musik: aber die Zukunfl ist noch offen, und sie wird jener grundfalschen Schopenhauerschen Definition von Musik als »Willen iiberhaupt«, die hie und da auf Wagner pagt, die jedoch im Wesentlichen den voriibergehenden Zustand von Unbestimrntheit verewigt, ein non liquet gemaf] der Unabgeschlossenheit des vorliegenden Materials entgegensetzen lassen.
88
Die sdiopferische Vertonung
Nur was von uns an klingt, kann hier also naher bringen.
Zurn Ersten macht der gebrauchte Ton jedes Geschehen sdiarfer, eindringlicher, sinnlicher.
Dcnn wir kcnnen als Horende auch gleichsam noch nahe tast en. Das Ohr ist zu einem geringen Teil starker als das Auge in die Haut noch eingebettet.
Nicht als ob der Ton herabzoge, aber er fullt gut aus und lagt uns derart etwas als wirklich empfinden. Wir strauben uns deshalb nicht grundlos dagegen, ein stummes Lichtbild anzusehen. Denn hier ist nur der optische Eindruck des Schwarz-WeiB ausgeschnitten, und da er einfach so gegeben wird, wie er ist, so entsteht gemag der Ausschaltung des Ohrs der unangenehme Eindruck einer Sonnenfinsternis, eines schweigenden und sinnlich vcrrninderten Lebens. Aber nun iibernimrnt das Ohr eine cigentiimliche Funktion: es lei stet die Vertretung aller iibrigen Sinnc, es hebt das Knistern, sich Reiben der Dinge, das Sprechen der Menschen lebendig von ihnen ab, und so wird die Tonbegleitung zum Lichtbild, wie vage oder schlieBlich genauer sie auch sei, gerade als auf ihre Weise photographisch crganzend empfunden. Ebenso lagt sich nun behaupten, daB der roncnde Fries, den die Oper der Biihnendichtung untermalt. nicht an sich schon wegfiihrt, sondern nahe, eindringlich, sinnfallig macht und das desto packcnder, je mehr sich die Mu,ik in die Weite der Handlung, der dramatischen Bewegtheit und nun gar erst des sonst Entlegenen, Dbersinnlichen hinausbcgibt.
Zum Zweiten aber verwirklicht der gebrauchte Ton [iihlbar versdiieden, je nachdem ob er ins blofl Sinnfallige oder aber ins Sinnhafte einfiihrt,
Sd10n unten mug darum alles entsprechend ansetzen und ins Dichtcre bringen. Das Singen, der Ton muf abgestuft und auch nichr nur dadurch verwirklichen, daB er abhebt, sondern auch dadureh, dag er einen gliihenderen Menschen einsetzt, daf er ruf].
Das bewirkr, der Ton muf sich aufsparen konnen, er muf an allen Stell en, wo nur das einfache, wenn auch bewegte Leben sprichr, moglidisr leidensdiaflslos zuriickgehalten werden. Wer
89
zuviel beweist, beweist nidus; und es war gerade der, allerdings leicht erringbare, Vorzug der gesdilossenen Oper, rezitativisdi zu begleiten und erst dorthin die Arie, die regierende Musik zu setzen, wo es dichter, »wirklidier« wurde in der Handlung, wo sich das Geschehen zusammenzog und die Menschen daher notwendig singen mufsten, Die offene Oper laBt es dagegen iiberall markiert zugehen; und nicht nur, daB dadurch vieles rein Handlungsmaflige unversrandlich bleibt, die Musik begibt sich hier auch sehr oft der frischsten und sdionsten Wirkungen plotzlich eintretender Heterogeneitat, deutlicher Mehrstufigkeit des Wirklichen. Nur urn diese nicht zu verlieren, sudit Wagner, sudit die derzeitig offene Oper unermiidlich zu steigen, zu fallen und wieder zu steigern, solchergestalt Niveauunterschiede in die an sich gleidimafsig bergige Landschaft des durchkomponierten Stils einfiigend. Aber das macht oft unleidlich iiberheizt und pathetisch, wo es dem Wort, dem Wirklichkeitsdrang nach gar nidit erforderlich ware. Wie hier in Wahrheit der sich abserzende und doch flieBende Aufstieg noch geschehen konne, zeigt etwa Verdis Othello; gewif doch laBt sich in diesem ganz einzigartigen Geniewerk an Stille, Tiefe, Reife, Fiille des Sprechtons (oft ganze Satze entlang auf derselben Note) und dann des Lieds, des Zwiegesangs, des wildesten Ausbruchs, des Heraufdonnerns der Katastrophe, der Akkorde des Endes der Heldenlaufbahn, - eine Vereinigung des abgestuften mit dem durchkomponiert dramatischen Opernstil erkennen. Hier miiflte also lediglich, paradox genug, dasjenige wieder am Ende der symphonischen Entwicldung geleistet werden, was an ihrem Anfang die Mannheimer Schule urn 1750 als das sich Verdunkeln, Erhellen, Verschieben, Diminuendo, Crescendo, mithin als Reliefbildung im Orchester geleisrer hat. Sofern eben die begleitende Polyphonie allrnahlich monoton und aus lauter Obersteigerung sdiliefilich zu einern neuen Continuo ohne aIle Okonomie musikalischer Realisierung geworden ist.
Nur ganz oben laBt auch bei sparsamer Verwendung des Oben die verstarkend ansetzende und verwirklichende Kraft sdieinbar nacho Und zwar dort, wo derTon blumig macht, die Scharfe abstumpft und jede Entriicktheit wohlig real, das heiBt in diesem Fall mit dem musikalischen nach auBen Kehren des Innern umkleidet. Das kann nach einem guten wie nach einem schlech-
90
ten Sinn hin ausschlagen; schlecht und flam realisiert ist die Wirkung, wenn einfach nur zur Stimmung geblasen wird, wenn der Held, wie Schlegel sagt, trillernd zum Tode abgeht, wenn wir, wie Schiller dem halbmelodramatischen SchluB des Egmont vorwirft, »aus der wahrsten und riihrendsten Situation in cine Opernwelt versetzt werden, urn einen Traum zu sehen «. Anders aber wird uns an jenen Stellen zumute, wo der Meister des besser Realen spricht, wo man die Primadonna und den niedrig verdichtenden Schmelz des Heldentenors vergiBt, wo etwa die Wagnersche Musik wieder »lyrisdi« zeichnet und sich in ihrem Adagio der Mozartschen Marchenoper, diesem ersten Teppich des Ontologischen, annahert, Das bedeutet jedoch auch dann in keiner Weise, daB darnit die verstarkcnde, inrensivierende, realisierende Kraft der Musik, ihre ungeheure Methode des Verwirklichens zurn toncnden Schweigcn, zur Realisierung der Tiefe, erloschen ware. Sondern umgekehrt, nur ihr Gegenstand ist tiefer geriickt, es ist der stillere, tiefere Kern, irgendeine letzte entscheidende Peri petie unci Schicksalsbcgriindung, die in den Schein der musikalischen »Realitat« ger.it ; in den Schein einer gleichbleibenden charakteristisdien Intcnsivierung, wie sie start des Sinnfalligen das Sinnhafte bringt, rnvthisdi macht, das heiBt eben die andere, tiefere Realitatsschicht eroffnet und statt der veristisdien Wirklichkeit der Spieloper, Abenteueroper, Handlungsoper die utopisdie Wirk!ichkeit der transzendenten Oper in Szene gesetzr: Spuk und Maskcnspiele, den Ladispiegel [iir die hcitere, den Zaubcrspiegel fur die ernste Oper ; die Musik, die erklingen muB, sobald das Ubcrsinnliche in die Handlung eintritt, damit, nadi Busonis guter Operntheorie, das Unmogliche der Musik dem Unmoglidien, Visionaren der Handlung sich verbinde und derart beide moglich werden. Derart also auch kehrt unweigerlich erschwert und auf sehr hoher Realitatsstufe die »Arie« der geschlossenen Oper, tieferhin der Bachschen Sammlung, der iiberdramatischen »Lyrik« zuriick, in apriorischcr Forderung; dem stctig bloB Vorletzten aller Bewegtheit, dem absoluten hierarchischen Mehr und Zielgehalt des Einschreitens, Hineinschreitens, der stockenden, mystischen Selbstbetroffenheit entsprechend. Wo immer das Harte und Durchsichtige des bloBen Worrgebildes verschwindet, wo immer nur der Schein der mu-
91
sikalisch tiefdringenden Erwedwng, Verwirklichung, Pointierung suo modo die Wunderatmosphare des untragischen Dramas erzeugt, dort entsteht auch jener mythische Musikraum der auBersten Realitat, der der transzendenten Oper mit dem Gnaden drama gemeinsam ist, und der als der Mythos der Liebe oder der Heiligkeit die seelischen Ontologien aufserhalb jedes moglidien Weltschi~sals, jeder weiterlaufenden Weltepik erschopfl.
Zum Dritten aber setzt die mit uns innervierte Musik einen leisen handlungsmaBigen Zwang; der dramatische Ton »dichtet« weiter und involviert sogar einen selbsttdtigen dramatischen Umrif1.
Zwar, daB der Ton so weit ziehe, wurde mchrfach scharf bestritten. So trennt Pfitzner durchaus das einzelne melodische Ausmalen von dem ganzen und begriindenden Zug dichterischer Art.
Es klingt unzweifelhaft bestechend zu sagen: wenn ich das Wesentliche einer musikalischen Arbeit angeben will, so werde ich das erste Thema pfeifen. Wenn ich aber das Wescntliche einer Dichtung erzahlcn soli, dann werde ich umgekehrt durchaus nicht den ersten Satz zitieren, sondern die Grundziige der Handlung oder den Plan des Ganzen berichten. Gerade so unsinnig, wie einem derjenige Komponist vorkarne, welcher sagte, er triige eine Son ate oder Sinfonie im Kopf, zu der er aber noch kein einziges Thema harte, erschiene derjcnige Dichter, welcher Verse oder Satze hinschreiben wiirde und sagte, das gabe ein Drama, von dem er aber noch nicht wisse, was darin vorginge, von dem ihm also die groBe allgegenwartigc Idee noch nicht aufgegangen ware. Das Einzelne gilt dann als die eigentliche Sorge des Musikers: und dieses schon Geborene, die kleine greifbare Einheit, der geniale Einfall als bei seiner Geburt schon Fertig entwickelt, ohne noch eines sinfonischen Auseinandergczogenwerdens zu bediirfen, ohne iiberhaupt jemals durch einen anderen Zusammenhang seine Wirkung zu verandern, isr nach Pfitzner das eigentlich wertgebende Element in der Musik. Umgckehrt sei das Durchwaltende, Allgegenwartige die eigentliche Arbeit des Dichters: als das erst zu Erzielende, als die grofse ungreifbare Einheit oder geniale poetische Idee, wie sie sich allmahlidi, start »komponiert« zu werden,
92
von oben nach unten niederschlagt, »verdichtet« und doch al[cin nur als bindende, das Einzelne begriindende Intuition des Ganzen ihren Wert besitzt. Wenn daher diese beiden so vollig vcrschiedenen Arbeitsweisen verbunden werden sollen, dann korme es nur insofern mit Gewinn geschehen, als das der einzelnen Kunstart allein angehorende Elementare betont und erb~inzllngsweise ausgeglichen wird. Es gebe daher ein schlechtes Musizieren, das breit erzahlend oder gar gedanklich werden will, und es gebe ein schlechtes Libretto, das entweder zu stark irn Einzelnen ausgefiihrt hat oder aber das als blofses Geriist zurn Aufhiingen von Duetten, Arien und Ensemblesatzen die sachliche Bcgriindung der Handlung verabsaumt. Die eigcntlichc Sen dung der Musik ist nach Pfitzner also, akzidentiell zu scm: sic hat auf selbstandige Formcnbildungen, auf den geschickt verteilten Kitt der sinfonischen Arbeit zu verzichten, die die ehemalige Trennung von Einfall und herkomrnlichen Tuttis.itz en zugunsten einer aus Einfall und Reflexion ununterscheidbar gemischten Einheitlichkeit des Ganzen aufgehoben hat. Nicht grundlos sei die Geschichte der Musikformen eine chronische Verlegenheit geblieben, musikalisches Einfallsmaterial untcrzubringen. Die Sendung der Poesie dagegen sei, substanticll zu sein: sie hat auf das sinnlich Einzelne zu verzichten, das heiBt, der Musik Platz zu mach en und dieser in einer TIloglichst knappen, oft auf Symbole zusamrnengedrangten Handlung sowohl die Stimmungsgrundlagen als auch die drarn.uische Begriindung, Notwendigkeit und Schicksalsidee aus dcm nur der Poesie zuganglichen Reich formhafter, komplexhafter I.ogik zu liefern. Deshalb liebt Pfitzner sich und Schumann und spielt ihn gegen Liszt aus; deshalb ist ihm der Freischurz und vor allem die Wolfsschluchtmusik das Urbild der vollkommenen Oper: die Grundfrage der Operndichtung ist gelost, und Pfiitzner sieht das gefahrliche Ineinander des drarnatisch crzeugenwollenden Musizierens in dem Begriff einer sowohl musikalisch wie poetisch elementaren, also spezifisch musikdramatischen Konzeption vermieden.
Vic!es daran ist nun so richtig, als es scharfsinnig ist, und es ist mcrkwUrdig, wie scharfsinnig oft das Falsche sein kann. Denn ware es so, wie Pfitzner sagt, dann hatten gerade die kleinen und mittleren Meister am instinktsichersten, mit dem besten
93
Einfall gearbeitet, Es gibe gewif ein leeres, errechnetes Arbeiten und eine Hochstapelei, die sich Beethovenisch gibt, wo nichts als Hohlheit vorliegt, wo das thernatische Gewebe nicht einmal Reflexion ist, sondern was die Tuttisatze waren, narnlich Schablone geworden ist. Es gibr nicht minder gewichtige Einwande gegen die Beethovensche Arie selber, klanglos, liedlos, allzu arm an Stimmen zu werden und bei allem Schwung oft unorganisdi zu kontrapunktieren. Ebenso ist Pfitzner im Recht, wenn er manche tote Wagnerstelle anmerkt, in der das Rezjtativ nichts zu sagen hat, weil auch der Text schwunglos bleibt, und in der das Leitmotiv nicht aus den rein symphonischen Grlinden der Wiederkehr, sondern nur gedanklich als eine Art padagogisdien Orientierungspunkts in die Musik eingesetzt ist. Wenn man daraus aber die Grenzgefahren zwischen Musik und Drama bestatigt sehen mochte, so gibt es hier doch die Korrektur, daB nicht Schumann oder Pfitzner oder ein anderes treuherziges, wengleich hochst achtungswlirdiges, der Inspiration wohlvertrautes Musizieren, bei dem jedoch die kurzen Augenblicke des Einfalls zum Einfall des kurzen Augenblicks pro domo zurechtgemacht werden, sondern allein Bruckner und Wagner diese »Schuld der Son ate an dem Ideal der Musik .. gutgemacht haben. Es geht nicht an, irgendwie Beethoven zu liberschlagen; und zudem, es gibt genau doch bei Beethoven hochsr bewegungszeugende Einfalle und wie erst Durchfiihrungen ihrer, deren dialektische Dramatik, aus der Spannung dieser Thernen-s Einfalle« anhebend, rein dem Dramatischen dieser Musik seiber angehorcn. Ais einer Musik, die syrnphonischen Platz braucht, und Weite, urn diese Art Musik zu sein, und der schon die vorwartstragende, einbezogene Zeit eine zeugende Gesarnrvision mindestens des einzelnen Satzes, wenn nicht der ganzen Symphonie nahelegt. Ja, selbsr der Komponist des Freischiitz und der von Pfitzner als besonders einzeln und dezidiert melodisch geriihrnten Wolfsschluchtmusik, selbst Weber fiihlt sich so wenig mit Pfitzners Theorie einverstanden, daB er in einem Aphorismus redit symphonisch bemerkt:
"Wahrend dem Lesen eines Gedichtes drangr sich alles sdineller der Seele voriiber ; wenig Worte reichen hin, die Leidenschaften zu wechseln und zu bestirnmen ; nicht so kann der Komponist schalten, seine Sprache bedarf langerer Akzente,
94
und der Obergang vom einen Gefiihle zum anderen legt ihm Hindernisse mancher Art in den Weg.« Ebenso laBt sich sagen: wenn schon der Widerwille gegen die grofsen Formen betont musikalisch sein soli, dann hat das symphonische Fortspinnen immer noch mehr Formen zerbrochen als die Additionen der Musik als Einfall. Und schlieBlich muB Pfitzners Nominalisrnus entgegnet werden, daB die Sonate und die ihr entsprechende Geburt des Wagnerdramas aus dem Geist der Symphonie nicht nur eine Hiilse vorstellt, eine der nachtraglidien, inreressanten, chronisdien Verlegenheiten, musikalisches Einfallsmaterial unterzubringen, sondern den vollig legitimen Leib cines eigenen Melos und seines ebenfalls zeugenden, inspir ativen, dramatisdi setzenden Kontrapunkts,
Darum, um das Rechte iiber die handlungsmailige Kraft der Musik zu finden: hier ziebt gerade der Ton, wachsend im Flug, wahrend das Wort nur fallr. Achtet man darauf, wie allein schon ein gutes Lied entsteht, so bemerkt man wie wenig darin nur Einzelnes verlebendigt wird. So ist bei Pfitzner seiber, bei Hugo Wolf, bei Bach, bei Wagner der Ton jeweils nur auBerlich dem Wort angepaBt und weit davon entfernt, gleichsam nur atomistisch aufzutreten. Es ist hier durchaus ein Geriditetsein auf das Wesentliche am Werk; dergestalt, daB nach der ridnigen Bemerkung von Louis bei Hugo Wolf das ganze Stuck in ciner iiberwiegend absolur musikalischen Entwicklung herausgesponnen wird. Wie sie nicht so sehr auf das Einzelne des Tcxtcs und die Jeweiligkeit seiner Stimmung geht, sondern sich an cine Grundstimmung im Anfang oder Verlauf des Textes halt, als welche nun musikalisch umgesetzt und zur begleitenden Folyphonie dieser wesentlichen Gesamtstimmung auseinandergclcgt wird. Das ist Freilich eine Grenze, aber gerade eine gegen das Einzelne, und dafiir eine deutliche Beziehung auf das Ganze, in das nun die Dichtung des Lieds oder auch der Oper urngekehrr ihr Einzelnes einzusetzen hat. Nicht immer braucht hier ja, wie in Pfitzners Palestrina, ein solcher Stilunterschied zwischen den lyrisdien Visionen des ersten Akts und dem bloB streitsiichtigen Kontrapunkt der Konzilszene des zweiten Akts zu herrschen; es gibt Gemiit, es gibt aber dariiber auch eine Mystik der Reise und der Zeit. So wenig man also auch die handlungsetzende Kraft symphonischer Begleitung inhaltlich
95
ubersdiatzen darf, so gewif gibt es hier doch vorn Fidelio ab einen rein musikhafl:en Zwang, der mittelst der melismatischsymphonischen Bewegtheit nicht nur der Handlung nachfolgt, sondern seiber Handlung, noch unbestimmte, namenlose Handlung, die Lufl:, das Tempo, die Stirnmung, den Boden, das Niveau, den dunklen, zuckenden, iiberbewuliten, zauberhafl:en, mythischen Hintergrund der Handlung erzeugt, in die sich nun, einzeln beliebig, insgesarnr gebunden, die biihnensinnliche Anwendung und gleichsam nur im Unteren nachsprechende textliche »Begriindung« einzusetzen hat, Es ist selbstverstandlich, daB dazu ein knappes, iibersichtliches, ofl: symbol weise versinnlichendes Geschehen besser taugt als ein bereits in Absehung von der Musik vollendet geformtes Drama; daf also Kabale und Liebe ein bedenklicheres Textbuch abgibt als eine StrauB-Hofmannsthalsche Beratungsarbeit oder die vollig secundum rem musicalem entworfenen Wagnerdramen, sofern eben die eigene Fiille, prinzi piell auch die geheimnisvollere Tiefe des Musikdramas keine schon geformte, keine rein poetisch geformte Dramatik ertragt.
Zum Viertcn aber wird dieser Art durch das von uns an Klingende, durch den subjektiv durchbluteten Ton sogar noch das sprechbar Ganze seiner Handlung latent iiberholt.
Das schlechte Wort ist an sich schon leicht zu storen. Es ist iiberf1iissig und macht sich dem Ton gegeniiber, den es klaren, dessen Stimmung es ausatmen will, lacherlich, wo es sich nur zeigt, Erst recht isr nicht grundlos, daB, gesungen, fast alles zu hoch gerar, daB in der Oper noch der arrnste Schiffer mit goldenem Ruder rudert, Niemand kann all das Zeug mit dem giflgefullten Ring und Emmas Lufl:gestalt verstehen, aber die Webersche Musik macht aus Euryanthe fast eine sinn volle Dichtung. J a, die Tauschung geht anderswo so weit, daB Pamina wie Beatrice wirkt, daB aile die billigen Regiekunststiicke der Zauberf1ete wie okkulte Visionen erscheinen, sofern eben die Mozartsche Musik das bloB Theatralische und auBerliche Gegenspielertum vertiefl: und zu jenen theosophischen Tatbestanden zuriickfiihrt, von denen im Schikanedertext seIber nur mehr Wirrwarr und dreiviertel Unsinn iibrig geblieben war. Es ist auch nicht grundlos, daf man zusammenzuckt, vor einem blolsen Trinklied von Studenten, als welches sich der wahrhafl: hollisd;
96
trei bende und stampfende Eingangschor zu Hoffmanns Erz.ihlungen scheinbar darstellt, wie es iiberhaupt nirgends in dicsem einzigartigen Meisterstiick zwischen Ton und Text -srimrnr «, geheuer ist. Oder wieder anders, wenn ein Gesell und dann die Lehrbuben mitten im Tanz abbrechcn und in harmonisch herrlich folgenden Quarten die Meistersinger ankiindigen, .11, ob es sich nicht urn bcqucrne Ehrcnrnanner, sondern urn den Einzug himmlischer Heerscharen handelte. Die Stimme jedes groBen Licds, jeder tiefen Wortmusik gleicht der Srimrne jenes gespenstischen Hergereisten aus Hoffmanns »Kreisleriana«, der erz.ihlt von vielen fernen unbekannten Landern und Menschen und seltsamen Schicksalen auf seinen weiten Wanderungen, lind dessen Sprache endlich »in ein wunderbares Tonen verhall te, in dem er ohne Worte unbekannte, geheimnisvollste Dinge verstandlich aussprach«, Solches aber ist allein darin gesctz t, dail der Ton das Wort iiberholt und so auch dem Ganzen, dem gesctztcn Niveau nach letzthin nichr ins stetig Sichtbare des Textes treffen kann, weil dieses Ganze iiber dem Ganzen der Dichtung hinausliegt. Deshalb kann man allerdings a urh nicht sagen, daB sich irgendeine Dichtung, gerade dem lerzren Ganzen nach genommen, anders als nur mehr oder mindcr belicbig und annahernd in den unbestimrnt fordernden dr.unatischen Musikraum einsetzen lieBe; sie folgt wohl in weiten Zusammenhangen der geheimen, iibermaBigen Handlungskraft der Musik nach, aber sie kann sich mit ihren entschleiemden, -Iogischeren. Mitteln dem musikalisch geforderten Nivca u nicht ohne weiteres als wiirdig erweisen. Auch wo die Quartcn weniger bcsonders klingen, auch wo die szenische Basis hoher gelegen ist als beim blolien Aufzug der Meistersinger, ist das vorhandene transzendente Drama stets armcr an Hintergriinden als die seine Schicksale, seinen Mythos zubereitende \1 usik; und dieses eben erst ist die iuahrbajle Grenze zwischen .ier symphonischen und dramatischen Bez iehung.
Folglich kann der Trieb, sich dies Entlegene nun in die alltag- 1 iche Sprache zuriick zu iibersetzen, auch in hermeneutisdicr Hinsicht keinc Bedeutung zufiihren. Hier vor allem werden "on ir gend einern Es des Tenens die lappischsten Dingc erzahlt, Sic crinnern, wie sich auch Bekker, der Beethovenbiograph, mit Recht sagen lassen mulitc, an die schlimmsten Erlauterungen
97
»zu unserem Bilde« aus der Gartenlaubenzeit. Hier feiert das Geschw atz von ausdrucksvoll flehenden Zweiunddreilligsteln, vom heiter lachelnden Violintrillcr, von dem dreimal erklingenden Unisono-Gis, das nach dem Scherzo im cis-rnoll-Quartett gleichsam fragen soll: was tue ich in dieser Welt? - scinen wcitverbreitcten Triumph. Hier sicdclt, mit klarendcm Geplauder, der selbstzufriedene Pfahlbiirger, der nicht nur etwas gesagt zu haben, sondern auch alles ins Reine gebracht zu haben glaubt, wenn er, in des AI usikfiihrers Zaubersprache, die A-Dur-Symphonie als »das hohe Lied dionysischen Heldenturns« reportierte. Bekker hat die Hilfsrnittcl, mit denen der Klavierlehrer die lahme Phantasie seiner Zoglinge zu verbessern sucht, zur exegetischen Wissenschafl: der Musikpoesie erhoben: und das soli dann bei Beethoven stchen, mehr noch, das soli der ausgedcutete, vorstellungsmafiig klargewordene Beethoven sein, ein hochst widcrwartiges Zeug, Takt fiir Takt das Wortchen bercit, dem gegeniiber noch der banalste Zeitungsroman wie eine Aeneis wirkt, Man kann es so oder so sagen, und wenn der andere Beethovenbiograph Marx den Gang der musikalischen Handlung der Eroika als den einer Schlacht im
T dealbild auslegt: der erste Satz gibr die Schladu selbsr, der Trauermarsch schildert den abendlichen Gang iiber das Schlachtfeld, das Scherzo ist die mit Lust und Lied erfiil lte Kriegslagermusik, und der letzte Satz schildert die eilig begliickte Heimkehr zu den Festen und Freuden des Friedens -,
so bleibt das auch gut, wei I die Musik damit iiberhaupt nichts
zu tun hat und ihre Tide diesem nachtraglich bildhafl:en Spiel auf popularer Vorstellungsbasis weder verneinend noch bejahend zuganglich rnadit. Dagegen ist gleichgultig, ob der cine oder andere Musiker sclber glaubte, cinen [rohlichcn Landmann darstellen zu miissen. Es fordert so gar wenig, zu untersuchen, wieweit Beethoven in Person, als Angeregter oder nachtraclidi Ceniefiender, dieses lahme Fabulieren unterstiitzt ~ zu haben scheint. Er hat gewill in spateren Jahren daruber ge- ~ klagt, daf die fri.ihere Zeit »poetisdier « war als die jetzige: »jedermann fiihlte damals in den zwei Sonaten op. 14 einen Dialog zwischen zwei Person en geschildert, wei I es gleichsam
so auf der Hand licgt«: und man weill, wie sehr es Beethoven drangte, den friiheren Werken poetische Oberschrifl:en zu ge-
ben, eben im Zusammenhang mit der Klage i.iber die abnehmcride Phantasie der Musikliebhaber. Nicht minder auch non licct bovi, wenn Jupiter Wagner, der von Dichtung Genarrte, oil die anfechtbarsrcn Ausdeutungen zusammentrug: so schliefst I:ach ihm das Andante der Mozartschen g-moll-Syrnphonie mit dcrn endlichen Bekenntnis dcr Seligkeit eines Todes durch Liebe, so -symbolisierr- hier die iibcrraschcnde Siilligkeit des Finales der Eroika die Vollendung des HeIden in der Liebe, indes 1111 Vorspiel zu Lohengrin cine Engelsschar horbar den Gral hcrnicdcrtragt ; - lauter Interpolationen zufalligster, beliebigstcr, von der Geniewclt Wagners selbsr widerlegter Art. Wenn f'olglich also auch Betthoven die Ouvcrriire zur Namensfeier ct wa nicht komponiert, sondern gedichtet habcn wollte, so iLi ngt diese Arbeitsverwechslung einmal mit dem Drang nach dcm »Ccistigen«, der \X'issenschafl: Angenaherren zusammen I dcmsclben, dcr Goethe das Dichten geringer schatzcn liell als die Erfo!ge in der Farbentheorie); und dann hat sich Beethoven unter dem Poetischen sicherlich nichrs anderes als jenes <;c;lwcifende Behagen in Stimmungen und Begeisterungen vorgcstellt, das man untcr »Poesic- irn Cegensatz zur Prosa, zur Prosa des philistroscn, traumlosen, unsymbolischen Lebcns verstchr. Irides, Beethoven ist kein Dichter, er ist weniger und rnehr als ein Dichter; und was nun gar erst die ihm scheinbar nnchfolgende Programmsymphonie an blokcnden Schafen, Schwtile des Kr ankenzimmcrs, tickender Uhr, rauschenden Wasscrfillen, Kiihle des Waldes und anderer, eng umgriffener, han:t! etikcttierender Photographie hinzugefiigt hat, lallt das programmatisch Poetische erst recht als blollcs Trittbrett zu dl"1l1 inncren, bildlosen Pathos, zu der inncrstcn Wortlosigkeit .lcr Musik erkennen. So mull man, auch ohne zu denen zu zahlen, die nichts als formal blciben wollen und ihre epigonal gehiirrcil oder crzeugten Formresiduen fiir »absolutc« Musik halreno mit Hanslick-Hcrbatscher Grenzwacht vor der indirekten Linic, - so mull man aufs Entschiedenste gcgen die prograrnmmusikalischen Essays prorestieren, die mit falschcm Fleisch und !lein bekleiden, sofern sic Intcrpolationen zufalliger, der Mus.k regional unterlegener Art als Sprachc i.iber Musik oder als die Obcrsetzung dicscr ewig nur fremdlandisch vcrtrauten Kunst in adaquate Kategorien ausgeben.
99
Aber auch das gute Wort, das dichterisch wertvolle, wird notwendig vor dem Ton versagen. Es verschl::igt darum letzthin wenig, wenn es nun Wagner so darstellt, als ob gar geschicht-
lich der Weg vorn Ton wiederum zum Wort und nicht umgekehrt zu gehen harte. Er lagt den Ton, vor allem im Ring des Nibelungen und uberhaupt grundsatzlich, theoretisch, nicht zu Ende reden, sondern greift auf das Unbedingteste zu den Kriicken des Textes zurtick, statt der noch ungeahnt -sprechenden«, expressiven Zukunft der Musik zu vertrauen. Nach Wag-
ner miiiite sich genau so, wie aus dem Chor die Instrumentalmusik entstanden ist, diese wiederum in das Drama urn jeden Preis aufzulosen suchen, gleich als ob die absolute Instrumentalmusik cine Gefallene ware, die aus der dialektischen Diffe-
renz des blof metallischen Klangs nun wieder nach der .'.1. ".' .• Riickkehr und Synthese des Worts, nach der Auflosung ihres
blogen Logogryphs in den dramatisch wiedergekehrten » Chor« ' verlangte. Und doch sagt Wagner sclber, der es so unerhorti .. ·.· findet, wenn auf den Trlimmern der Operndichtkunst der Mu- I siker als eigentlicher, wirklicher Dichter erscheint, seine eigene i!I
Theorie desavouierend: dag, im Hinblick auf Beethovens mu- .'i, ••. ~.' .• ·'·. sikalische und Shakespeares dramatische Behandlung des Co- .
riolan, Shakespeare nur wie ein im Wachen Forttraumender Beethoven erscheint, uber sich noch dieses Gliihende und uner- t tragbar Reiche als Schein der eigentlich musikalischen Vision. Aber abgeschen davon ist Wagner auch in einem historischen Irrtum befangen, der iibcrsieht, daf sich die friihesten Opern schon wahrend der alleinigen Bliirezeit des Orchesters ausgebildet haben; und was sparer aus dem Chor entlassen wurde und sich in der instrumentellen Sonderform weiter ausgebildet hat. ist keine geschichtliche Mitte, deren chorischer Beginn nun mit dialektischem Umschlag als dramatisches Ende wiederkehren mligte, sondern der Chor ist unbeschadet der florentinischen und aller spateren Opern, unbeschadet auch des Musikdramas und trotz der glanzenden Ausbildung des ihm dienenden Instrumentalkorpers durchaus der oberste, ausdrucksmaditigste Teil des Orchesters geblieben, mit steigendem Verzicht auf die textliche, programm-musikalische, dramatische » Logikund als der gewaltigste Hohepunkt der gerade mit ihm erbliihen den reinen Symphonie. Es ist und bleibt so das Schicksal
100
nuch des guten Worts, auch des dichterisch wertvollsten, auch des musikhaft vollig einbezogenen, vor dem Ton sdiliefllich zum Bettler zu werden. 0 namen-namenlose Freude, singen Leonore und Floristan: auf ihren einfachsten und rohsten Stufen schon iiberwindet die Musik leise die Dichtung und macht sie zu ihrem Widerschein. Selbst der schlichteste, selbst der migbrauchteste Ton ist unfahig, Texte blof! zu illustrieren; der dunkle Urlaut der Musik lost jedes Wort, selbst jedes Drama in sich auf, und innerster Wandel, eine Fiille geheimster Gesiclite, geheimster Augenblicklichkeit und La tenz drangr in den singenden Flammen grofser Musik an uns voriiber. Es gibt daher erst recht keine grope Musik, in der zuallerlet.zt noch ein Platz fiir andersartig Gestaltetes und gesprochen Dramatisches ware oder deren Voraussetzungen nicht weiter hinaus lagen als die Endpunkte auch selbst der meisterlichsten und arriviertesten Poesie; wie sich denn das erhoflte Hellhoren, das Erbe des erloschenen Hcllsehens, von dem blog poetisch Mythischen formell und gegenstandlidi nicht weniger unterscheiden diirfle, als sich das Zungenreden der Jlinger von dem blolsen julianischliternrischcn Glaubenwollen an den Glauben unterschieden hat. Zwar fragt uns Nietzsche, ob man sich einen Menschen denken konne, der den dritten Tristanakt ohne alle Beihilfe von Wort und Bild rein syrnphonisch aufnehmen konnre, ohne daf er vor diesem Wiederklang zahlloser Lust- und Weherufe veratmete. Warum sollte er nicht? ist dagegen zu fragen; die Musik isr nichr dazu da, urn vor der Mystik zu schiitzen oder ge<chiitzt zu werden; und das Lichtbild Apollons, das »Die Gehurt der Tragodie« iiber dem dionysischen Ozean aufgehen lassen will, bleibt wie bei Wagner so bei Nietzsche eingestandcncrmalien eine Tauschung, eine holde Tauschung in Mag und Gestalt und universalibus post rem statt ante rem, hinter der sogleich wieder die Urrealitar des Dionysos, tiefer gesehen, des Christus zusammenschlagt, so dag der logische Zweck dieses Nietzscheschen Quidproquo vollkommen unverstandlich bleibt. Die Musik regiert schlcchthin und will absolur werden, es gibt grundsatzlich keine andere als absolute und darin per se spre~ende, rein nur noch spekulativ deutbare Musik. Das wahrhaft symphonisch Entworfene und zu Ende Gedachte kennt auf die Dauer keine Zwisdienraume seiner Welten, in denen nun,
101
wie bei Epikur die wirklichen Gotrer, so hier die Gotter der Poetik ihr wie immer hermeneutisch iiberfliissiges Dasein fiihrten.
Die Deutung oder fiber das Verhalmis
zwischen absoluter und s pekulativer AI usik
Das bcdeutet nun Freilich nicht, daf jedes Sprechen iiber den Ton zuschanden werden miiilte. Gewiil, der gute Zuhorcr ist seltcn. Und noch etwas muf hicr bereits ganz entschieden betont wcr dcn, bevor wir ins Einzelne der tonalen, harmonischen, rhythmischen und kontrapunktischen Beziehung cintrcten. AIles steht jeweils nur auf zwei Augen; es wird nirgends rnoglich scin, aus diesen Mitteln direkt und ohne ein neues 1ch einzusetzen, auf dasjenige zu schliefien oder dasjenige erschlieilen zu konnen, das dem rczcptivcn Menschen zuganglich ist und den Kiinstler allein bewegt: Seele, Ausdruek und Inhalt.
Das Was des Ausdrucks iiberhaupt
Was suche ich nur, wenn ich hare? Ich suche, wenn ich zuhore, inhaltlich reicher und vermehrtcr zu werden. Es wird rnir aber nichts gegeben, wenn ich bloil bcqucm erleiehtert mitschwinge. Es sei denn, dail ich es mir selber hole, weircrgchend, inhaltlich, iiber den Genuf hinaus, Selbsr der Kiinstler wird nicht ruhrcn, nichts besagen, sofern er tatsachlich wahrend der Arbeit nichts als nur die Mittel will.
Denn man karin auch kunstlerisch verkiinden und predigend sein. Wiehtiger, als dail die Auilenstehenden Gesang horen, wenn ein Mann im heiBen Bauch des pharsalischen Stiers schrcit, und erst reeht wichtigcr als der Mechanismus, verrnittelst dessen Sehreie in Gesang verwandelt, mitgeteilt werden, sind die Schreie selber, ihre unabgelenkte Echthcit und Ticfe. So geht es auf die Dauer nicht an, die gestaltende Gesinnung in ihrem bloil formellen Niederschlag aufzusuchen. Dergestalt, dail alles dilettantisch ware, was sich nicht nach aufsen drangt und sich nicht im Technischen so sehr bcfriedigt fiihlt, dail die Vision erst in diescrn Kuileren des Werks ihr vollkommenes Wachstum und die Betatigung ihrer Echtheit erlebt. Nichts
r02
kann falscher, zufalliger und kunsthistorisch begrenzter scin als dicses; es liegt allem, was sich aussagen muf], gleichmailig fern, clem malenden Kind und dem schnitzenden Bauern nicht ferncr als dem groilen Kiinsrler. Man sieht zwar bei Lukacs »Die Secle und die Formen« diese rein formhafl-objektivistisch werckndc Meinung vollig dargestellt, neuklassiseh betont, aber sie sr.uumt hier aus eincr Spreehweise, die sich an Werken und lor men festhalt, urn letzthin doch nieht diese, sondern bei Gelcgcnheit ihrer, also ironisch, indirekt, cssay istisch den ferns ten, cigcnst gewonnenen Tiefsinn zu meinen. Ein Verfahren, das im cinzelnen z wcifcllos aufserordcntlich fruchtbringend wirken k.rnn, das aber im ganzen, als Methode eines Systems, als Zeichcnocuterei der Werkheimaten auf Grund durchgangiger Formanalyse, doch das Unbedcutende iibcrlastet, die inneren Grcnzen chiffernhafter Formbeziehung nicht ohne Willkiir festscrzcn kann und das Miihsarne, Uneigentliche, Flaubertsche des ncuvcit lichen bloil stilhaften vcraulserren Schaffenmiissen vercwigt. Man hat vielrnehr als der, wie man ist und nicht verl1liigc dcssen, wie man es macht, sein vollauf bestimrntes k iinst ler isches \Vas, noch ganz abgesehen davon, dail die niichterne, rein technische Atelierdefinition dem Bediirftigen, Ubcrschwanghaften des kiinstlerischen Willens und seines Ob. nicht gerecht zu werden vermag. Lustig, hafllich, schon, hcdcurend - das sind alles die kurzen Fiihler und Gcfiihlstone ci'lel noch flachen Zuhorcrturns. Griin mit Rot, Spielbein, Steh["in. Kontrapost, Querstande und neapolitanische Sext - das '.;nc! glcichfalls kurzatmige Dinge, Formeln, wie sie Freilich untcn, nicht zu lange, dazu gchoren, wie sie zur Mitteilung, 71111 padagogischen Horos des prinzipiell unabgeschlossenen Kunstwerks notwendig sind; Baume, die den Wald anzeigen, dc aber der Wald nicht sind, und die sich bestenfalls hilfskonst:'ulztiv mit dern Geist des Waldes, mit dem durchaus schon "~I, Inhalt kiinstlcrischcn Gehalt der Werksphare decken. Man cb:f auchnicht glauben, den einzelnen Darstellungsweisen dadllrch einen jeweils selbstbedeutenden Hintergrund geben zu kiinnen, dail man sie gesehichtlich auftr agt ; dail man die Formen des Romans, des Dialogs oder anderer Talcntrnittcl wie ~111f eincm sich drehenden Firmament von geschichtsphilosophid:cr Geistigkeit fixiert erblickt, der die moglichen Aussagefor-
r03
men kommen und gehen laBt; daB man also die Geschichte der kiinstlerischen Wer- und darin Washeiten zu einer Geschichte mittelalterlich-realistischer Wieheiten umdeutet. Es handelt sich hier nicht urn Farbe, Stein, Sprache als den Stoffen, die schon abirrend genug wirken, sondern eben urn das Formen, urn die Sorgen der Akribie, urn die Fragen des Wirkungs-, Vermittlungswillens, die sich fiir den Kiinstler selbst vor die Aussicht auf die einzig zu bedenkende Gebaltsphdre schieben konnen. Der Kiinstler aber braucht nicht immer so rein werkhafl: an sich zu sein, daf seine Erlebnisse in ein unzertrennliches Biindnis mit den technischen Formen der spezifischen Kunstart des Werkes einzutreten haben, urn ja nur die prastabilierte Harmonie zwischen Vision, Form und darin erst gewonnener Dingrnaterialitat zu erreichen.
Schon die zuhorenden Menschen gelangen anders nach Hause. Gerade von hier und jetzt ab mag das Kiinstlerische wieder als eine versetzte seherische Begabung erscheinen. Gewill, was nicht ausgesprochen ist, besteht nicht, aber es ist der Wille, der Inhalt, der iiber die Mittel gebietet, Und es scheint, daf man das Gesagte in diesen Tagen nicht mehr so strenge, werkhafl: von sich abzuhalten braucht, urn es als Ausgesagtes zu vernehmen. Ichhafl:, Wirhafl: also ist es dem neuen Kiinstler wieder moglidi geworden, auch ohne daf sich die allzu sehr gena herten Regenbogen und Wolkenziige als Nebel urn uns herum legen, ein Kunstwerk, das Wesentliche des Kunstwerks ohne aufhaltenden, distanzierenden Formbegriff zu schenken. So wird das Ungekonnte ofl: sonderbar tief ; kein guter Autor, sagt Jean Paul, zeigt sich im Hemd, was wir dafiir halten, ist's Chorhemd; die Mittel seiber sind agitatorisch, sie treten nur als das eine oder andere, dem Belieben des Kiinstlers anheimgestellte Verwirklichen ans Licht, ohne daf dieses Formen im geringsten inhaltlich deterrninierte. Elpore beginnt Elpore zu bleiben und als solche durchaus erkannt zu werden, auch wenn sie dem traumenden Epimetheus zu nahe tritt ; es leuchtet allmahlich das uns Bedeutende an sich, das andere Ich und der andere Gegenstand, der Kiinstler und Kunstgemabes deterrniniert; und nicht eine das Jenseitige etwa zur kiinstlerischen Immanenz auffangende Form. Wenn der wesentliche Wille steigt, so vermehrt sich freilich auch das Geformtsein seiner
104
Gcgcnst:inde, der Wohlklang rufl: viele und wahre Bilder empar. Aber es ist hier das geschaute Wesen, das sich seinen Korper baut, und wenn dieser, die Form der Verwirklichung, die iugere Wirklichkeit des Werks, als denaturalisiert oder irn hohen Grad abstraktiv erscheint, so ist dieses ein nachtraglicher Eindruck und iiberdies hauptsachlidi nur abstrakt in bezug auf cbs natiirliche Vorkommen des dargestellten Gegenstands. Denn an sich ist die neue expressionistische Wesensbildung genau so »naturalistisch« und blof deskripriv, wenn auch nicht so vollendet deskriptiv Fur astralisch Vollendetes, wie die Crabsteine mit dem Horusnamen, das Relief des Bel Merodach oder die Fliigelstiere Assyriens und des Propheren Ezechiel. Hier ist ein neues Direkt- und Absolutsein an der Arbeit, das die scheinbar selbstandig aufsteigende Forrnardiirekronik: den gutcn Satz, die Flaubertsche Miihe der Niveauausgleichung ge'>viE als untere Gegenstandsbestimmtheit, als Vordergrund-Prius irn geschauten Gegenstand besitzt; aber nicht, als ob hier etwa, wie in Stilzeiten, das Werk so lang ware wie die Aussage oder, wie in Astralzeiten, das vollendet deskriptive Formzcichen das unvollendet expressiv-deskriptive Siegelzeichen erdriicktc. Sondern wo immcr nur grofle, personlidi expressive Arbeit vorliegt, ist es der Wille, das Subjekt und sein Inhalt, cler letzthin allein aus den Mitteln, Forrneln, den wertlosen, hlIltCrgrundslosen, herauszuhoren ist, ist es das Eigentliche an dn Abstraktheit, iiber Mittel und auch iiber Befestigung und i ormhafl: unterem Gegenstand, ist es das andeutende Siegel oder pr das beginnend sich deckende Wirgeheimnis, das l diogramm. Nur in einer Weise eben laBt sich iiber Form gegens.aridlich sprechen: dort namlich, wo das Formelle, Konstrukrive, Objektivierende keinc Verrnittlung, sondern ein gegen'::indlicher Teil seIber ist, wie vor allern in den Biihnenwirkungen, im Rhythmus, vor allern auch in den verschiedenen, die gestaltenden Subjekte zu Kategorien ihres Soseins determinierenden Arten des Kontrapunkts, iiberhaupt in allen Zeitund eingedenkenden Ortsproblemen der Kunst. Hier hat sich das gestalten de Subjekt wahrhafl: in eine »Forrn« als seinem tieferen Aggregatzustand hineinbegeben, die demnach den unteren, sozusagen erkenntnistheoretisdien, sich metaphysisch k nochenbildenden Teil der Gegenstandsreihe seiber darsrellt,
10~
une er Freilich von dem eigentllcben Leben, Inhalt, Tiefsinn der dsthetischen Gehaltss phiire immer noch durch einen Sprung zu
I ch und Wahrheit gescbieden ist, zu Siegelkrafi und Expression, zum Idiogramm der enthiillten lnwendigkeit, der Lebensfigur, Menschheitsfigur. Es ist nun gerade die sonderbarc Kraft diescr Tage, daB man die Ziigcl anscheinend loc-kerer, genauer gesagt, bewulitloser halten kann und doch dcm echten Haus zufahrt. Es ist die erstaunliche Barbarei der Kiinstler, daf ctwa das rein Malerische, wenn es innerlich notwendig wird, beliebig iiberschlagen oder rein musikhaft werden kann und ahnliche »Dckadenzen- mehr, unerhorr vom Standpunkr der Akribie aus, so wie man friiher, zur Zeit der bcginnenden Gipsabgusse und Ornamentenscharzc des Unwesentlichen, tadclnd zu sagen pflegte, dieses oder jcnes alte Bauwerk sei nicht besonders »rein im Stil«, Man betreibt hier jenes Kuhne und so gar nidit Sturmund Dranghafte (denn dafiir ist es viel zu sehr bek iimmcrt, vie!
zu wenig Freude am blofscn Krafliibcrschuii, viel zu strenge Verantwortlichkeit gegen den Gegenstand), - jcnes hochsr Di- ,:_L .• ~.;,; rekte, das bisher nur und gerade die allergrofstcn Stilisten , reu-" ig und hellsehend, in ihren Alterswerken exekurierr haben: ~
~li·
subjek tiv, iiberformell, Deskription des Wescns zu sein. Derart ;;;
geht auch das »Werk« voriiber; die Augen sind stark gewor- '~ den, man braucht nicht mehr seine heilsame Darnpfung und vielfaltige Umleitung, die die iiberschwelligen Transzendie- ~l; rungsreize abschwacht und auf cine groBe Flache verbreitet, da- 'I~ mit sie nicht auf cinrnal heriiberdringen oder wie anders man ••. '
~~:c:ec~ !~~~~:~:~nd;;~7:s~:iS~~~;h~~y~~;::;teftJe~~~:~g~~t~
kommt mit anderen Worren eine neue, direktere, urbildliche ~, Betonung des etwas zu sagen Habens herauf, die kaurn deni Vorwurf des Dilcttantismus scheut, ja bci der das Dilettanti- ~ sche, das apriorisch Dilcrrantische, rein »Inhaltsasthetische« - $I sofern nur die eigentliche Stiimperei der individuellen Arrnse- ,.i ligkeir, der negativen Expression ferngehalten ist - einen me- i taphysischen Grad erlangt. Den des Abschubs alles GenieBens; den Gewinn der Ichaussage des Werks; den rnoralischen Norni- I nalismus gegen aile verselbstandigte Indirek theit ; den desk ripriven »Naturalismus- oder, besser gesagt, expressionistischen Realismus des »Subjekrs«: und schlieiilidi die Kraft der Ansage
106
oder wie es war und wie es harte sein konnen, sein soli en, die \Viirde der Erkenntnis, der spezifischen Erkenntnis einer <isthetischen« Wirklichkeit und des utopisch-moglidien Ideegchots ihrcr Sphare,
barLlm eben kann von hier ab Kunst wieder als eine versetzte scherische Begabung erscheinen. \"qie weir war in deren ersten Blutctagen allcs von der Absicht des Zeigens und der schonen \Virkung entfernt: es war verboten, sich den Masken zur Un;rc: t zu nahcn, ja es gab Gotterstatuen, die iiberhaupt nur in eincrn vollkornmen vcrdunkclten Raum, eine andere als unsere Schwclt crfiillcnd, verehrt werden durften. Das primitive und :\llcch gotischc Kunstwollen haben, gleich der gesamten Musik, mit dern Wollen dcr Kunst als cines beabsichtigten Wirkungsbcc;riffs, als eines kleinen, wesenlosen stilistischen Ausschnitts c.nrr \'Velt ohne Enttauschung, nicht das geringste gemein. Es he !ldclt sich dicser Kunst, aller groBen Kunst gegcniibcr durchXll, nicht urn die objektiven oder auch norrnativen Forrnproblcrnc des asthctischen »Gefallens«, das die unwichrigste Sache yon der Welt ist, sofern allein schon der Begriff »Aisthesis« nicht gcfiihlsbetonte Ernpfindung, sondern durchaus dasselbe \\;c Wahrnehrnung, Phanomenologie, adaquatc Erfullung be,i".1tct. Es handelt sich, immcr wieder, urn das Inhalt-Was des ,',-!)l\,~cschricbenen Menschhaften und reines offen gehaltenen, dlXh mysterisch gebliebenen Grunds.
I),11 heute zuhor endcn Menschen Freilich ist das Letzte nicht 1',(11 r so lcicht gegeben wie in den scligcn Zeiten der Gorter!I!IH': aber dafiir lassen ihre Kiinstler die Pfeile, die langsam "'~\".cordcnen pfeile des Ausdrucks wenigstens wieder nach der '."'utcrischen Richrung fliegen; und wie das Heilige nicht tiefer 11, his zur Kunst herabsinken karin, so laBt sich auch umgekrhrt das farbig verdunkeltc Hellfiihlen expressionistischer K l'1'Q mit ihrer uropischen Inhalts-, Gegenstandsorientierung ,"s .lcr nachste Raurn vor dcrn Haus einer kornmenden Parusie \ vrchr en. Nur bleibr. abschliefsend zu sagen, der Kiinstler, auch d,'r, wclcher kiinstlcrisch am Ausbrechendsten predigend, eri;c'1l1end, inhaltlich sein will, stets im Scheinen stehen. Die in,c-I haft vorhandenen asthctischen Bildnisse sind aufregende, c\hcr vorerst nur virtuell aufgliihende Glasgernalde, welche die Menschen andeuten, weiterdeuten, doch auch wieder entlassen.
T07
Und solches ist daher das Kriterium der rein dstbetiscben Erhellung, auf ihre letzten Kategorien hin angesehen: wie leonnten die Dlnge uollendct werden, ohne da/1 sie apokaly ptiscb aufhoren; wie konnte jedes Ding und jeder Mensch an seine oberste Grenze, dem Sprung entgegen, getrieben werden, dargestellt, das heillt immer noch, wenn auch mit expressionistischer Abkiirzung und Direktheit, gespiegelt und doch, was dariiber das Wichtigste ist, vollkommen erleudirer, solange das innereobere Licht noch verborgen ist und der Sprung seiner ganz anders verwandelnden Einsetzung des Herzens Jesu in die Dinge, die Menschen und die Welt noch aussteht. Wo dieses letzte asthetische Bemiihen nicht errnattet und derart absperrend, verblendend, heidnisch immanent gerar, wird das grolle Kunstwerk ein Abglanz, ein Stern der Antizipation und ein Trostgesang auf dem Heimweg durch Dunkelheit; und doch eben nur Ferne, Scheincn, Abglanz, erklarter Widerspruch aller Vollendung auf Erden, aulierstande, den bediirftigen Menschen selbst bereits in der verzweifelt antizipierten Glorie wohnhaft zu machen. Friiher, als man noch nahe war, das heifit, bevor sich die Augen verdichtet hatten, bevor es die neuzeitlichen Stile, Stilisierungen gab, harte man Fliigelstiere, obere Saulenstellungen, das Geheimnis des Querschiffs, Marchen, die transzendenten Bindungen der Epopoe, das gottlidre Leben seiber nach seiner gegen die Welt zu gelegenen Glanzseite im kiinstlerisch-deskriptiven Blick: dasselbe, was jetzt anders, truber, dunstiger, abendlicher, warmer sich erbellerul, hinter abgelauiener Welt- und Cotteslogik, als beginnendes Wirund Grundgeheimnis - die Dostojewskische und Strindbergsche Sphare einer reinen Seelenwirklichkeit, einer rein moral ischen »Transzendcnz « der Begegnungen, der Wolbungen und Durchblicke eines auch iibersozial Menschhaften bilden durfle. Farbig, am farbigen Abglanz haben wir auch dieses Leben, diese Predigt; blickt man aber in die verborgene Sonne seiber, so isr das nicht mehr Kunst, eine immer noch innerweltlich virtuelle Vollendung, sondern Ich bin's, inneres, bildloses, ja ganz eigentlich werkloses Gottsuchen, in dem das Objektive so wenig mehr als Hilfskonstruktion vorkommt, daf nur noch die Wiedergeburt, die Einrichtung des Herzens als Werk erscheine, Das ware dann - hinter jeder Kunst - Moral und Metaphysik
108
dcr Innerlichkeit und ihrer Welt, ein neues mediumloses zusich-in-Existenz-Stehen der Subjektivitat und ihrer Un-Welt, das deutlich die Irnrnanenz des kiinstlerischen von der Transzcndenz des dergestalt direkten oder religiosen Gegenstandes rrennt.
Die philosophische Theorie der Musik
Trotzdem bedeutet auch dieses noch nicht, dall jedes Sprechen iiber die Musik, gerade als wenn es tiefer geht, zuschanden werden miillte. Ein Gleiten ist nicht zu befiirchten, der gute Zuhorer hat seinen bestimmren, immer noch kiinstlerischen Pl.itz. Es kommt nur darauf an, einen Punkt zu finden, von dcm aus cin Blick auf die gleichsam in den Fenstern des Werks licgcnden utopischen Bedeutungslander zu werfen ist. Dabei hlcibt es freilich die Frage, ob man iiberhaupt eine salche, wenn auch rein pradikativ vollzogene Erweiterung fiir notig halt. Dcnn der Bogen cines grollen Werks ist rein asthetisch durchaus geschlossen, oder vielmehr, er besitzt, woran bei einer engeren Betrachtung kein Zweifel ist, in seiner kiinstlerischen Formwelt, auch Siegel welt seiber den asthetisch ausreichenden Schl ullstein, ohne einem transzendierenden Deutungsgebilde rnchr als immanenten Raum zu lassen. Aber nun stehen wir hicr. und das Werk steht dort, es isr uns, so sehr wir auch voriiber gehend gcfangen genommen worden sind, ein Lcichtes, w;cdcr von dem Werk wegzugehen, urn fiir neue, darunteroLler dariiberliegende Zusarnmenhange frei zu werden, und so mull cs daher einer Gcsinnung, die noch nichts [iir sich beruhigt sein lalit, der der Apparat in jeder Sphare ein Elend ist, wohl erlaubt sein, auch die Gebilde der Musik als bloGe befe\tigte Unterwegs zu betrachten und so lange als blolic vestigia zlJ'abaseos zu verfolgen, bis sie mit in dem Reigen der geschichtsrhilosophischen Sternbilder, ja des ganzen Weltprozesses er~dlC'inen.
h ist nicht schwer, in dieses andere Horen vorzudringen. Zwar l't von au lien neben der Lust zunachst nichts als die Ahndung g,';cben. Auch diese wirkt zumeist nur geniclser isch, willenlos, au\ruhend und so noch ganz lich im Leeren verloren. Sie entH! t schon aile Tiefe, ist aber auf dieser Stufe, als erstes blofses Sc'!\\,clgen am Ton, noch nicht brauchbar, ist falsch, zufallig,
109
beliebig. Denn nur was geformt ist, erscheint, womit gewiB nach allem Gesagten nicht gefordert wird, hier die Laden zuzuhaltcn, urn ja nur das kleine, umzirkelte Leuchten in der Ritze formkritisch nachzeichnen zu konnen. Jedoch was dahinter wirkt, der volle Tag, enthalt auch -Forrn«, hat in sich rnindestens Form als untcre Gegenstandsbestimmtheit, und an dieser erheben sich dann erneut die Begriffe der einzelnen Musiker, der Musiker als Begriffe. Hier wirkt dcr Schopfer und sein Was als jeweilige Form, nieht beliebig, wie es nun einmal da ist, sondern es ist nicht anders da denn in einern geschichtlichperiodischen System der musikalischen Ichgcgcnstande und Spharen. Hier wirk t vor allem der Ton als Mittel, sich zu au Bern, als Mittel, das gebrochen werden muB, aber dennoch schwebend tr agt. Hier wirkt des weiteren die Harmonie als Formel, und vor allem, sich vollig ber eits ins personlidi Vielsagen de hereinbegebcnd, das besondcrc Rhythrnisieren, der graziose, stirnrnige, dramatische Kontrapunkt, als Werkform, als Spezies, als Siegelcharakter grolser Musik er. Rhythmus und die drei bishcrigcn Weisen des Kontrapunk tes sind bereits untere Gegenstandsbestimmtheiten an sich und bestirnmen derart eben jcnes geschichtlich-periodische System aufsteigender musikalischer Ichgegenstandc und Spharen, das an den graBen Musikern bislang erschien. Abcr diese Formen sind freilich nur unter e Gcgenstandsbestimmtheiten, und der wirklich her auszubringende musikalische Gegenstand hat sich nicht, Wie das verschlungenste Gewebe noch nicht dichtet, was es ja auch nicht soli; wie die drarnatisch-symphonische Bewegung nur einen Raum der sehr allgemeinen Bereitschafl setzt, in den nun das poetisch ausgcfiilirre Musikdrama »bcliebig« eingefiigt werden kann: so klafft auch zwischen der transz endierbarstcn Spezies und dem letzten Siegeleharakter groBer Musiker oder gar dem letzten Gcgenstand, dem Idiogramm utopischer Musik tiberhaupt, cin lcerer, schadlicher, den Obergang erschwerender Hiatus. Es ist nicht moglidi, sclbst in der theoretisch erleuchteten, philosophisch bezogenen Rhythmik, Kontrapunktik direkt z u jenem zu kommen, das dem weinenden, erschutterten, zuinncrst aufgerissenen, betenden Zuhorcr von Ahndung gegenwartig ist ; anders gesagt, ohne dieses Besondere von-sichErfahren, sich-ausgesagt-Fiihlen, menschlichem Oberholen der
110
Thcor ic, wie es erst am Ende dieser Untersuchungen als Interpoiienmg eines neuen, Freilich dem Musiker zutiefst verwandten Subjckts und seiner geschichtsphilosophisch metaphysischen SprJchvision diskutierbar wird, stehen sarntliche transzendierc,ldcn Speziesbeziehungen zum Apeiron still. Von neuem erSChl,i!H derart, auf soleh nicht mehr musikgeschichtlicher Stufe yon Ahndung, der Ton seIber, als allein gemeintes, als sprengcndes Aha-Erlebnis des gelichteten Nebels, der Ton, der gehi;rte. gcbrauchte, vernommene, hellgehorte, von Menschen geILlll!,enC, Menschen tragende Ton; nicht mehr als Mittel, gewiB allch niclrt als astralischer Schrein, wohl aber als oberste Aura der Rczeptivit at, als letztcr Stoff der Seele, des Kerns, der La[,']]Z, des Selbstsymbols, auf das Musik iiberhaupt aufgetragen ir: als oberstes Phanomenale des musikalischen Ausdrucks und ldiogramms, des musikalischen Geistcrreichs. Wo also die Dichtung die musikalischen Kreise storte, kann sie die Deutung geIluin crw citern, kann sie eingedenkend und fern von jedem bl"f)en Kommentar auf die urbildliche Landkarte einzeichnen. 7w,u »unsere Taten selbst, so gut wic unserc Leiden, sie hemmen unscres Lebens Gang"; aber es gibt noch ein anderes Blut, chs rnitarbcitct, einen weitertreibenden Begriff des kiinstlerisck,tl Wesens, den »Ictz ten « Kiinstler als Metaphysiker der K unvt, das ist, als letzten Bewahrer des kiinstlerischen Gegenstands, als Schopfer des Gesarnrkunstwerks inhaltlicher Art, im homogenen Medium des spckulativen Begriffs. Es gibt FolgI;,,]' ciuc von se1ber schopfcrische, nicht nur kommcntiercndc, sondcrn spontanc, spckulative Asthetik, und erst in dieser ihrer Deutung errichtet sich die wahrhafl »absolute« Musik, enthIlt sich das ertraurnte, das utopisch weiterwachsende Schlof c1cr Musik.
I J I
Mittel, Formeln, Formen und Phiinomenale der transzendierenden M usiktheorie
Der Ton als Mittel So mag hier also nichts von selber klingen.
Es kann nur in uns bliihen und erwachen. Der Ton wird von uns verdichtet, qualitativ gefarbt und verschwebt sogleich. Nur wir sind es, die ihn erheben, mehr noch, die ihn feststehen und mit unserem Leben sich beseelen lassen. Zwar ist es nicht zufallig, daB gerade dieser zarte, durchsichtige Leib erwahlt wird. So gewif auch die Trunkenheit nicht im Wein, sondern in der Seele steckt, so fiihlbar wirkt doch im natiirlichen Ton ein hiniiber Schwcbcn und Sprechen, das ihn allein vor anderern als musikalischen Stoff geeignet macht. Aber schon, was die Quinte angeht, so ist das alles nur schon, weil es ausgewahlt ist, weil es zu weiteren, unnatiirlichen Beziigen veranlalit, und erst im Bruch mit diesen direkten Neigungen vermag der Mensch zu smgcn,
Die Harmonielehre als Formel So gilt darum, sich weir hindurch zu fiihlen.
Wer nur einfach hort, und er kann dabei sehr ergriffen sein, merkt nicht einmal davon etwas, wic die Tone zusammengemischt sind, und es besagt ihm nichts, es zu wissen. Allerdings beirn Kiinstler bliiht, wenn nidit Fesrtag ist, der Handgriff. Er isr noch mehr als blofier Handgriff, und vieles, das sich scheinbar unbcwulst gibt, stamrnt aus einer au Berst kalten, mit bewahrten Wirkungsmitteln arbeirenden Erwagung, Deshalb pflegt das alles sich auch so kraflig aufzuspielen und die Musiker nach alter Weise in Schuler und Lehrer zu teilen, mit der ganzen kritischen Dberlegenheit, die forrnclhafte Sprache und technisches Wissen rechrens verleihen. So kann man schon aus diesem Grund nicht thcoretisch sprechen, ohne die eigne, von den Musikern selbst ausgebildete Theoricwisscnschafi zu beachten. Ware hier nicht zu hoffen, daB der Kopf, in dem sidi die technischen und die logisdien Kenntnisse beriihrten, rein sachlich schon, durch Selbstanziehung beider Gebiete, etwas
I 12
Lncrhortes flnden miiBte? Es gibt in der Tat eine gewisse unycrmcidliche Art hochgezogener Augenbrauen, wo nicht gar dcr ;cradlinig weiterdenkenden Hoffnung in philosophischen K rciscn (die vielleicht noch aus dem alten Vertrauen auf matl1(matischen Scharfsinn stammt), sobald Begriffe wie Terz oder IIcapolitanische Sext oder Querstand, iiberhaupt die ganze, an ,iell schon so geistig abstrakr scheinende Gestalt der Harmolliclchre in den Gesichtskreis treten. Und nicht nur Grillparzers ;\ nncr Spielmann, auch Hoffmanns Kapellrneister Kreisler hat blcich dem jungen Wagner Augenblicke, in denen ihm die musil.alischen Zahlenverhaltnisse, gar erst die mystisch gesreigerten Regeln des Kontrapunkts, ein Sanskrit der Natur, an sich Frschauern erwecken. Und dennoch, sobald Kreisler, der sich ills Unendliche allerorten einwiihlcnde Kreisler, der vol len, ertoncnden musikalischen Wirklichkeit gegeniiber steht, vom formalcn Rand ins reale Zentrum versetzr: ist das Geriist langst cingcfallen, er trifft wieder mit dem ergriffenen Laien zusarnmen, die Realitiit der Modulation ist das Wunderbare selber, wclchC's im inneren Geiste wohnt. Ebenso, wir besitzen eine ~roGe Anzahl vortrefflicher Thcoriebiicher, und wenn wir im lolgendcn bcsonders auf Schon bergs Buch zur praktischen Erlcdigung der Frage verweisen, so geschieht das nicht - so sehr cs uns entgegenkommt -, weil es von einem schaffenden Musik er gcschriebcn wurde, der nur ein System der Darstellung und "cines der Natur angestrebt hat, sondern aus dem tieferen Grund, weil bezeichnend ist, daB hier gerade der arrivierteste \ Icthodiker dafiir sorgt, daf die Form ihren Gegenstand nicht sclbst zweckhafi iiberspiele.
\Vcr cs kann, darf so sdireiben, wie ihm beliebt, Krafiig geht lucr alles auseinander zugunsten dessen, der innerlidi muf]. Fiir dic5C!1 aber gibt es, wenn er handwerklich weif], was er tut und Jwrsonlich weifl, was er lassen kann, iiberhaupt niches mehr, das h;':Qich, unerlaubt oder dissonant ware. Er darf in freier, schwchender Zeiteinteilung komponieren, ja, er darf jeden Zu\,lll1l1lenklang schreiben, wenn er auch sdieinbar iiberhaupt n!cht harmonisch abzuleiten und lediglich durch die Stimmfuhrung zu erklaren ist, Es bleibt so nicht einmal sprachlich erlaul.i, von harmoniefremden Tonen zu reden. Jeder Zusam-
113
menklang ist moglidi und darf deshalb schon rein als Zusammenklang fiir Harmonie gesetzt werden.
So wenig wie ein Mifsklang besteht irgendwie selbstandig eine Tonart. Sie ist schein bar aus dem Notenbild iiberhaupt nicht fortzudenken, noch ganz davon abgesehen, dag die gesamte Dominantwirkung nur auf Grund der bewahrtcn Tonalitat gestaltet und begriffen worden ist. Trotzdem hat Schonberg beispielsweise dem letzten Satz seines fis-moll-Quartetts keine Vorzeichnung mehr gegeben, obwohl es der Hauptsache nach fis-Dur angehorig ist, wenn auch die ausdrucksvollsten Gebilde darin, die alterierten Quartenakkorde, von jedem Klanggeschlecht gelost worden sind, von aller Tonalitat, Der Ton, von dem das alles ausgeht, kann ja ruhig in der Luft schweben. Es bleibt, wie Schonberg sagt, statt das Snick im gleichen Ton zu schlieflen, immer noch die Moglichkeit, die Beziehung das cine Mal auffalliger anzudeuten, das nachste Mal mehr zu vcrwischen. Was dadurch entsteht, ist eine Art von unendlicher Harmonie, die nicht mehr notig hat, jedesmal Ausgangsland und Reiseziel rnitzutcilcn, und noch weniger die Entdeckungsreisen in den weitcn Feldern des tonalen Vakuurns scheuen darf. Es steht iibrigens schon seit langem so, daf es nicht mehr die Kadenzen sind, die die harmonischen Entwicklungen eines Satzes beherrschen. Deshalb ist auch unnotig, andere Tonarten aufzustellen, urn der schwankenden Tonalitat zu Hilfe zu kommen, also neue, untergeordnete, hier und da gewif iiberraschend brauchbare Mittel, wie etwa die exotische Ganztonskala, zum System zu erhohen. Es gibt nichts, zu dem die chromatische Tonreihe nicht ausreichte, sobald man nur aufgibr, aile moglichen Abweichungen von der alten Skala gutzuheigen und trotzdem am Ende die Phrase von der Herrschaft der Tonalitat aufrecht zu halten. Soli diese Herrschaft erzielr werden, dann miissen sarntliche Leittone ausbleiben, die nicht zu binden sind, und dann miissen vor allem, wie es die Klassi-" ker tatsachlich getan haben, gewisse Proportionen in den Modulationen eingehalten werden. Aber es geht nicht an, sich so zu verhalten, als ob man frei ware, und aile Moglichkeiten dieses Zustandes auszuniitzen, indes man die eigentlichen Gefahren und Verpflichtungen des Freiseins nicht auf sich nehmeni will. Das ist von Schonberg nidir iibel so gedreht worden, daB\
114
es geradezu als storende Unsymmetrie erscheine, wenn die Beziehung auf einen Grundton aufrecht erhalten bleiben soli, nachdem die harmonischen Moglichkeiten des ilbermaliigen Dreiklangs und vor aIlem der vagierenden Akkorde nicht blof vercinzelt, sondern fortdauernd, unter dem Druck eines fortdauernden Ausdrucksgebots, angewendet werden, das im Grund noch iiber dem Axiom der Tonalitat stehen diirfte. Das Lied schliegt dann mit Neu, Unendlich oder Unerfiillt; es geht ohne anzukommen, der Sinn liegt im Weg, und das ehemals wirkende Zentrum des Grundtons, die liegende Stimrne, der ausgchaltene Orgelpunkt oder auch nur seine ideell gehorte und erst in der Reprise wieder real gewordene Forderung, ist hei der schwebenden oder aufgehobenen Tonalitat verschwunden. Start dessen gibt es viele Gruppen von Toniken, ja jeder Akkor d kann die harmonische Definition durch seine eigene Tonika erlangen; es gibt intermittierende Tonikabeziehungen cdcr eben wechselnde Zentren, und das Insgesamt, das erlaubt, rill Werk zu schlielien, urn es notgedrungen aus dem Stand der idcalen Unendlichkeit auf reale Endlichkeit zuriickzufiihren, braucht keine harmonisch gegebene Beendigung zu sein, wenn auch die lebendige wie die kiinstlerische Form bisher nicht erl.iubte, anders als von sich aus, von dem eigenen Belieben, W:lchstum und Apriori her die inn ere Grenze der Sache als die cigentliche Gestalt ihrer Form diktiert zu bekommen. Daher mull hier das Begrenzende von etwas anderem genommen werden als von der Tonika des Ganzen, und es unterliegt keinem Zweifel, dag dieses Andere iiberhaupt kein voreiliges Abbrechen sein kann, da es keinem endlich erreichbaren Ziel zutreibt, sondcrn dag es seinen hochsten Punkt und moglichen Schlugpunkr in dem srarksten, echtesten Ausdruck einer inneren Gewalt, Maglosigkeit, Unendlichkeit, mithin in einer keineswegs :nchr harmonisch, eher nodi rhythmisch diskutierbaren Tonika gewinnt. Oberhaupt sdilagr bei Schonberg das Harmonische, \\"0 es auf eine tiefere Begriindung ankame, allermeistens ins Kontrapunktische iiber. Was fast von seIber entstehen mag, akkordisch ungesucht, obwohl bestandig als solches in die Stirnmen eingestreut, kann auch nicht harmonisch gerechtfertigt odcr bcgriindet werden. Wenn man etwa zwei Stirnmen in der c- Dur-Skala iiber einer liegenden Harmonie c-e-g Gegenbe-
I 15
wegungen ausfiihren Et{h, so entsteht daraus cine Fiille der herrlichsten und interessantesten Dissonanzen, ohne da~ dieser plorzliche und phantastische Akkordreichtum eine andere Quelle als den Kontrapunkt der einfachsten Fingeriibung besa~e. Bei diesem selbst aber kann alles fur alles gesetzt werden, und deshalb la~t sich, so selbsrverstandlidi auch die rein handwerklich kontrapunktische Tiichtigkeir vorausgesetzt bleibt, im weiteren erst recht nur vorn ganzen Menschen, vom Moralischen des Kiinstlers aus entscheiden, ob an einer harrnonisch-
kontrapunktisch schwer verstandlichen Stelle ein »Fehler- bge- .. I ..•.. ~.: ...• · .... macht wurde oder ob eine nutzlose Grubelci vorliegt oder a er •• '
ob cine unbekannte Regel, das hei~t ein einmaliges, nur dafiir notwendiges, an sich leeres und uniibertragbares Abbild jewei- 'i: liger innerer Bewegung, Hille und Klangdichtigkeit zu akzep_i' tieren ist. Es ware also nicht minder verfehlt, wollte man [iir .~ den leeren kombinatorischen Reichtum, Fiir die prinzipiell end-'t losen akkordischen Durchkombinierungen der Harmonie einen $ besonders geisthaltigen Anlaf im Konrrapunktischcn, im Un- "! terwegs des Kontrapunkts aufsuchen. , Derart bewahrt sich aufs Glticklichste die endgiiltige Betonung ... 1.; des inneren Miissens, wie es au~er Dissonanz und Tonalirati
drittens auch jede selbstdndige harmonische Ausdrucksrelation 'I"" sprengt. Je einfacher freilich ein Lied gestimmt ist, desto deut- '
~~:;I;;;::ti~i a~~,:;:n :i:aj:tci,~~:nf~o;~:~:'~:;i;n~i:;~:: !.
Heideroslein in Dur setzt. Denn was sind das fiir GefUhle, die I sich ohne wciteres durch das dunklere Moll als Un lust und Idurch das hell ere Dur als Lust bezeichnen lassen, odcr wie wiederum Schubert fragt: gibt es iiberhaupt »heitere- Musik? Und welch ungeheure Oberflachlichkeit rnacht diese Schwarz- Wei~Technik aus Schrnerz und Freude und aus dem Tieferen, das weder das eine noch das andere ist, sondern dieses eben ist, das Shakespeare so sehr zwicspaltig an der Musik riihmt, als der »schwerrniitigen Nahrung fur verliebtes Volk «, Schon bisher hat die simple Zweiheit Moll-Dur, wie sie als Weichheit oder :
Glanz ins Gefiihl tritt und in der geringeren oder gro~eren Verschmelzung der Teiltone ihren Grund hat, vielleicht auch in dem sich nach unten entwickelnden Charakter des Moll-Dreiklangs, als dem Fall von eincm oberen Grundton nach der
116
Tide, - schon bisher also hat diese Trennung stimrnungsmaiiiger Art in zahlreichen Werken ihre Bedeutung verloren. Wahrschcinlich wiirde iiberhaupt niemand aus Moll und Dur auf Trauer und Freude raten, wenn sich nicht die onomatopoetischcn Namen von der run den oder eckigen Form ihrer iiblichen :z.cichen (unseres b und h) als dem B-molle und B-durum der mirrclnlterlichen Notenschrift herlcitercn. So ist schon Bach sehr hjufig vollkommen gleichgiiltig gegen den angenommenen Stimmungsausdruck der Tongeschlechter, ja man findet bei ihm zuweilcn sogar Moll fur Entschlossenheit und Dur, vor allem wenn die Terz vorherrschr, fiir Milde und Wehmut gesetzt. Obcrdies, wie sich die sieben alten Kirchentonarten aufgelost l.abcn, so werden auch die zwei aus ihnen iibrig gebliebenen Moll- und Dur-Skalen irgendwann einrnal, vielleicht in der ncuen Lcittonaffinitat der chromatischen Skala, ihre Auf losung tinden. Schon der iiberrnaliige Dreiklang, der sich auf der dritten Stufe der leitereigenen Dreiklange in Moll ergibt, ist nicht «infach stimmungsmaflig als Mollakkord weiter zu halten. Er I:illt sich nicht nur beliebig in Moll oder Dur fortfuhren, sondern besitzr auch gleich den von Schonberg so genannten vagicrendcn. das hei~t tonartfremden, an den Grenzen der Tonart schweifenden Akkorden cine keineswegs eindeutige Zuordnung z u i rgcnd einern in Moll oder auch in Dur inkarnierten Stirnmungscharakter. Man findet zwar bei Hugo Wolf, auch bei Puccini den iibermaiiigen Dreiklang als den Akkord des Briite",; aber Wagners vollig gegensatzliche Verwendung dieses '\kkords im Schlafrnotiv und dann aufgelost im Walkiirenruf oder akkordisch im Nothungrnotiv Ia~t aufhorchen. Es zeigt sich, daf gerade diesem wichtigen und fiir die ncuere, ausdrucksreiche Harmonik so sehr bezeichnendcn Akkord eine wcitgehendc Beliebigkeit seines Charakterbilds, und nach dcr Moll- oder Durseite hin ein gewisser Hermaphroditismus anhaftct, Es ist daher vollkommen richtig, wenn auch Schonberg dart, wo ein Akkord sehr ausdrucksvoll klingt, in nichts anderem als der Neuheit die Ursache dieses Ausdrucks zu erblicken wunscht. Deshalb ist beispielsweise der glanzende und harte v('rminderte Septakkord, der cinstrnals neu war, neu wirkte und so bei den Klassikern fur alles, fur Schmerz, Zorn, Erre~llng und jedes heftige Cefiihl stehen konnte, jetzt, nachdem
117
der Radikalismus versdrwunden ist, unrettbar in die blofle Unterhaltungsmusik als sentimentaler Ausdruck sentimentaler Angelegenheiten gesunken. Mithin wird der neue Klang nur dann gesdirieben, wenn es dem Tondiditer darauf ankommt, ein Neues und Unerhortes, das ihn bewegt, auszudriicken. Das kann auch ein neuer Akkord sein, aber audi Schonberg glaubt, daf der ungewohnte Akkord nur deshalb an einen exponierten Posten hingestellt wird, darnit er das Auflerste leiste, darnit er neu sage, was neu ist, narnlich einen neuen Menschen, damit also der neue Zusammenklang einer neuen Gefiihlswelt zum symbolischen Ausdruck verhelfe. So wenig es moglich ist, das Neue in der Wirkung, in der rezeptiven Zuordnung eines Akkords anders zu begreifen, als daf er ungewohnlich ist und allein schon deshalb oder besser gesagt, nur deshalb befahigt wird, auch das Bewegteste und Krafligste auszudriicken, so wenig ist es denkbar, das Notwendige in der Wahl, in der formal-kausalen Zuordnung, das heiBt in der harmonischen Ausdrucksrelation eines soldien Akkords auflerhalb dieser seiner bloflen syrnbolisdien ZweckmaBigkeit irgendwie sachlich hinterweltlich, konstitutiv zu deduzicren. Was konnte es also sein, dieses sonderbar Identisdie des inneren und des tonalen Trieblebens, dieser Zusammenfall von Ausdruckswahrheit und Konstruktionswahrheit, dieses durch Psychologie gemilderte oder erlaubte »natiirliche« System der Akkordphysik, wenn es nidit die unbeirrte Fortsetzung des -tonalcn«, das heilit des menschlich entliehenen Trieblebens, der menschlidi entliehenen Tonvitali tat in einer konventionell gar nidit weiter absteckbaren harmonischen Expresslonslogik ware?
Das Belieben wird gewif durch die Zudit und Regel iiberlieferter Gewohnheiten erzogen. Aber ist dieses geschehen, dann bleibt allein noch das Ausdrucksgebot der genialen Natur, ihre Starke, Bliite und Wahrhaftigkeit als regelgebend bestehen, im kornpositorischen wie gegensrandstheoretisdien Sinn. Dann wird letzthin alles harmonische System belanglos; was zuerst wie lauter Verbot und Gesetz aussah, wird zur blofsen Sperre fiir den Unbegabten und zur Erziehung fiir den Begabten, der sidi bald genug selber zu sagen hat, wie weit er gehen darf und wie jenes subjektiv Irrationale besdiaffen sein soli, das sidi iiber Regeln, letzrhin audi iiber Taktstridi, Dissonanz, Harmonie
IIS
und Tonalitat hinwegsetzen darf. Daf einer etwas ist, daB er diese oder jene Form wahrhaft braudir, daB er diese oder jene unverwediselbare Urfarbe und personliche Aura urn sich hat, dafl er als der, der er ist, geschiditsphilosophisdi fallig ist, das blcibt im Grund jenes einzig wesentlidi Angebbare, das Kaulbach von Michelangelo oder Bungert von Wagner untersdieidet, das iiberhaupt die Kopie von Original trennen laBt; und nicht die kleinen Unterschiede eines blofsen Regelwesens vermittclnder, agitatorisdier Art, die es tatsachlidi unmdglidi machen, Kaulbach durch Begriffe wie dekorative Pose oder Historienmalerei zu widerlegen, ohne sdieinbar auch Michelangelo mit zu treffen und zu verurteilen. Die blolle, jeweils geeignetste Forrnel ist nidit einmal unbedingt personlich vielsagend; sie ist erst recht keine iiberpersonliche Chiffer, und sclbst wenn sie dies ware, so ware sie es lediglich in einer epochal begrenzten Geltung und nicht in der Weise, daf das bisher Geeignetste zum Ausdruck, also das iiberliefert Historische, unter Absehung seiner damaligen expressiv-symbolischen Bindung und Notwendigkeit, in Theorie iibergehen konnte, in eine vorn Wahlgebot absehende harmonische Gegenstandsbeziehung.
Beziehungen des Rhythmus als Form
Anders scheint der Taktsdilag nidit ganz vorn Abspiegeln frei />'.1 sein.
Es ist nicht nur, daf wir uns darin als atrnend zuredit finden. Dicses innerlidi Leere konnte hochstens Fiir den erleiditernden, -russcheidenden, gehobenen Stimmungswert des Verses gelten. 'londern es ist fiihlbar ein tieferes Leben, das in der musikabchen Zeit wirkt. Nicht nur, daf es anders ablaufl als die :iuf~cre Zeit, in der es gesdiieht, sondern es wirkt audi ohne wciteres gehend, gewinnend, gesdiiditlich.
So wird etwa in einem bestirnmten Taktteil, sdiarf geschlagen, e.n Paukensdilag Fallig, DaB er nicht kommt oder daB er an ciner anderen Stelle kommt, kann das Cesidu des Ganzen zersr(iren. Wenig ist hier sdion alles: man kann den einfachsten Cassenhauer hymnisch verlangsamen und umgekehrt den Wagncrschen Pilgerchor durch blolle Tempobeschleunigung zu einern unsaglidi spiefsburgerlichen Walzer verwandeln, ja sogar
119
die Erinnerung an cin altes studentisches Trinklied nahelegen. Oder es wird versucht, das, was iiber den Zeilen zu lesen ist, zu ignorieren und etwa den 21. Takt der Beethovenschen dmoll-Sonate an den Anfang zu setzen, urn derart das Jetzt und Endlich dieses Taktes, den ganzen vortrefflich gestellten Triumph der in ihrn erreichten d-moll-Tonika auszustreichen. Dann zeigt sich, sollen nicht aile Farben zerflieiien, wie besonders bei Beethoven fast alles auf das Gespannte, auf das zur rechtcn Zeit Geschehende angewiesen ist.
Sie kann Freilich ofter verwirren als aufklaren, diese Kraft, horbar die Pulse klopfen lassen. Man versteht von hier aus Wagners Haf gegen den Rhythrnus, der sich ja aueh auf anderes als die italienische simple Taktierweise bezieht. Danach werde uns als den blofi Sehenden gleichsam die Hand zur Verstandigung mit dem Traum gereicht. Dadurch, dafi er abteilt und phrasiert, durch die rhythrnische Anordnung seiner Tone, trete der Musiker in eine Beruhrung mit der anschaulichen plastischen Welt. In das blofie sieh Erhellen, Verdunkeln, Versehieben, in das magisch Fliefiende der Tongebilde schneiden in der Tat die Taktstriche ein und die li..hnlichkeit, nach welchen die Bewegung sichtbarer Kerper sich un serer Ansehauung verstandlich kundgibt. Die aufiere Gebarde, welche sich im Tanz durch ausdrucksvoll weehselnde gesetzmafiigc Bewegung festgelegt hat, scheint somit fur die Musik dasselbe zu sein, was die Korper wiederum fur das Licht sind, welches ohne die Brechung an diesen nicht leuchten wiirde, genau so, wie ohne den Rhythmus, ohne das Zusammentreffen der Plastik mit der Harmonie, die Musik nicht wahrnehmbar sein wiirde. Es ist mithin nach Wagner die aufierste Seite des Tons, die sich hier der Welt zukehrt, die in der konsequenten Ausbildung dieser ihrer li..ufierlichkcit das wohlausgestattete Spekrakel der Oper verlangt, wahrend sich die innere Seite als das von der Erscheinung und den Relationen ihrer Rhythmik befreite unmittelbare Traumbild des ruhenden Wesens aufschlagt. Das wiirde also bedeuten, daf das Zeitliche zwar die padagogische Rolle einer einzelnen szenischen Verdeutlichung spielen kann, dafi aber, genau so wie uns der Ring ins Grobe, Breite, Untere und Siditbare fiihrt, wahrend Palestrina und der Choralsatz den Taktwechsel fast nur durch eine leichte Veranderung der harmonischen Grund-
120
[arbe anzeigen, so auch die wahrhaft ontologische Musik insgesamt dazu gehalten ware, den Rhythmus nach altchristlicher Weise aus ihrem Reich zu verbannen. Wir konnen dem nicht 'iillig zustimmen, so sehr diese Einw ande auch manches leere Geformtsein, manche gewisse, freilich nicht nur zeitliche Korpereitelkeit an Quartetten, auch manche Verwirrung und Einmischung dionysischer Tanzrhythrnik eben an Wagner seiber z u treffen scheinen. Wir brauchen zudem dem Zeitlichen nicht mchr unbedingt zu fluchen, wenn wir es segnen; nicht nur, dafi bercits Beethoven und die Synkope gekommen sind, und gerade die Tristanrnusik, dieses Wallende und so gar nicht Fafibare, ihrc aufierste zeitliche Geformtheit und rhythrnische Kultivier theit besitzt. Sondern wir gehen auch philosophisch einer Arbcitsweise entgegen, der die Zeit etwas anderes bedeutet a ls unbedingte Diesseitigkeit, als blofler Ablauf dieser Welt, als bloll vorletzte, noch dramatische Aktion, sofern eben das mit uns, durch uns wandernde Wesen nicht mehr »ruht« und das Starre nieht mehr der einzige theologische Zustand ist. Derart k.mn sieh in einern neuen Gedrange, in einem an Beethoven und Wagner immer tiefer gesdiulten inruiriven Rubato, in einem c:c·heimnisvoll bewegten und synkopisicrtcn Adagio als dem oruanisch abstrakten Rhytrnus gerade das tiefere sich Selbstz.ihlen der Seele zutragen, ohne jeden Verrat an Plastik oder .nich heidnisehe Biologie. Es gibt jetzt sdion Falle, wo sich - wic etwa in der ruckweisen Bewegung, die dem Adagio des Priesrers in der Zauberflotc, dem Erwachen Tristans, der Hcirnkehr Parsifals und der mystischen Mittagsstunde, vor a llcrn aber auch dem ganzen Vorspiel zum zweiten Teil der achten Mahlerschen Symphonic eigentiirnlich isr - wo sich : rrcndeine Korrespondenz mit dem okkulten ZeitrnaS, mit den selrsarn punktierten Rhythmen des okkulten Schreitens oder 1\ ufsteigens einzustellen scheint. Dort klingt auch zumeist die 7wcite Musik, jene andere Art von Tonen, der geheime Atem, [Fe geheime Atmosphare von Musik, selbsttatig schwingend und voll von dem Driiben wie die Luft in Tintorettos Abendrnahl Aber nicht nur hier, sondern auch was den ganzen Verbuf eines Satzes angehr: seine tiefliegende, noch kaum entdeckte rbythmische Tonikabeziehung iiberhaapt -, hier vor a llern wird die Zeitgestaltung substanzial; keine Formel, son-
121
dern eine Form, keine Kriicke auf naturalistisdiem Boden oder auch bloGe triviale Korperschonheit, sondern die Chiffer zu einer seelenhaften Aktion, die sich im wesentlichen inn en, in dem Gegenstandsgebiet der Musik seiber abspielt.
Gerade bei Beethoven ist die rhythmische Tonika aller Harmonie iiberlegen, lost deren Amt ab und wird mit fortschreitender Sprengung der Tonalitar immer mehr zum Sieg berufen sein: wie anders auch sollte man jetzt schon, ohne diese Musik in der Musik, Beethoven verstehen konnen? Er treibt ruhelos, er laBt verloren gehen, urn darin zu laden, er ballt still und unmerklich zusamrncn, urn es sparer desto furchtbarer zu entz iinden. Er fUhrt, zerrt, schickt hin und her, er behandelt die kleinen melodischen Gebilde wie leblose Wesen, er sieht Massen von Musik vor sich und unter sich, der ungeheure Stratege der Zeit, aus denen er die tauglichsten fiir seine Absichten auswahlr. Ganze Gruppcn von Noren folgen aufeinander wie cine einzige diirre, aufsparende, spannende Geschlechterfolge: aber nun, beim jetzt, bei einern einzigen rhythmisch-dominanthaft iiberbegnadeten Genietakt erfolgt der Blitz der Verschwendung, und die riesigen Massen sdiiitten sich aus. Indem Beethoven das rut, indem er keine Themen komponiert, sondern einen ganzen Satz, eine ganze Senate, laGt er die wechse!nden Zustande unserer Kraft mitspielen, jagt er die Zeit in den bislang gelassenen Kontrapunkt und erzeugt mittelst dieser Ereignisform das Abbild einer Geschichte, in der sich nicht nur die Foige unserer innersten Lebensalter wiederfindet, sondern eben auch das vordem so gespenstische Dasein der Zeit selbsttatig sein Haupt erhebr. Wenn romanhaft das Zeitliche noch zwischendurch geschieht, hodist wichtig, aber ohne anders als nur am Heiden, an seinem Alter, Enttauschtwerden, Reifen, je nachdem, sichtbar zu werden, so ballt die Sonate die Zeit wie ein Eigenes zusammen und laGt diesen ratselhaflen Arbeitsschein seiber horen. Es gliiht und stampft darin; es ist hier ein namenloses Rufen, Warten, Klopfen, Eintreten, Ankommen, Zogern, iibcrschwanglidies Zusammen wie sonst nur noch auf der Biihne des allerkonzisesten Dramas; vorzUglich aber die Ankunft ist das Urgeheimnis der Beethovenschen Musik, und dieses ist wesentlich ein rhythmisches Geheimnis. Die leidue und die schwere Zahlung, die Gruppen, Halbsatze und Perio-
I I
I
122
den der Phrasierung sind hier eigene flieflende Substanz: jedes Din" hat in der Beethovenschen Sonate seine Zeit, sein nachprui"l)ares Nidir-Andersseinkonnen gemaf seiner Stellung im /\ugenblick, seine Schwere und Wiirdigkeit, seine Gcburt und Erscheinung im methaphysischen Termin; und das scheinbar subjcktive Schema dieser Zeit ist nicht nur einfacher Zusammcnhang oder blolle abgefeimte Formelregie, sondern, da aller Etlekt ursprUnglich methaphysischen Grund hinter sich hat, zugleich siegelhaftes Gleichnis, gegenstandlichster Rhythrnus und das innerste, realste Wirkungsschema unseres luziferischen Char ak ters. Hier ist Flamme und geheimster Uhrenschlag: der erste Satz drangt drama tisch hiniiber, der zweite ruht in sich selber, in der Iyrischen Fiille seiner unmittelbaren Verstandigung, der dritte Satz, vor allem die Coda, offnet die innere TUr, den Marsch als geheimen Choral, und gibt sein spates, dunkles, ckstarisches Bekennrnis - ein allerletzter Syllogismus der Entdcckung dcr Seele.
So ist der Taktschlag tatsachlidi und ungesucht voll von gegenstandlich-matapsydiischen Abspiegelungen und Beziehungen. Wir sind die Wandernden, es ist unser Gehen und Kommen, das in den Dingen geschieht. Oder vielmehr, die Reise ist bercirs dinglich bcgonnen, und wir leben in dieser Zeit physisch und organisch entweder gerade noch mit oder aber wir iiberhoi en sie, [iihrcnd, ins real Ungeschehene stiirz end, als schopfnische Wesen. Dafiir gibt es eincn einzigen, zutiefst iiberall v erwandten, wo nicht identischen Zug, der gerade das symphon: Id1 eingefaEte und das iibrige hisrorisdi-prcduktive ZeitgeIchchen srrukrurell verbindet. Denn hier wie dort treibt das Gcscheh~n ins Weite, und das Ende kann nur von innen her kornmen, kann iiberhaupt nicht anders als vom Geschehen her und als Zie! kommen. In beiden ist die Zeit durchaus Beharr cn des Vorher in dem ]etzt, also Sparen, Dauer, Aufbau, Erbschaft, Vorbereiten und Sammeln, bis etwas erfiillt sein kann, lind derart die reingemachte, herausgehorte, zielgeladene, musikalisch-historische, von Vernunft und Vorsehung bewegte Zeit, dcr Rhythmus als die Musik in der Musik und als das Logische im Kosmos zur Wirkung gelangt. So geht aber auch das sich Ereignen bei einiger Kraft der Gestaltung und des Uberblicks
123
in ein neues Raumliches ein, urn derart das zufallige Nacheinander in das begriffene Nebeneinander eines »cntwickelten« Inven~ars iiberzufiihren: musikhafi in das klanglich-kontrapunktische Raumsubstrat einer Fuge oder insgesamten Symphonic, philosophisch in den leuchtenden, qualitativ diskontinuierlichen Geschichtsraum einer in sich abgeschlossenen Epoche oder auch der vdlligen Weltgeschichte, sobald nur ihr Ganzes u~erachtet des Decrescendo der sich an ihrem jeweiligen Finale wieder aufrollenden Aktualitat geniigend einhcitlich und utopisch gebunden schwingen kann. Schliefslich, beim Einen wie bei dem Anderen treibt die tatige Zeit auf ein unbekannres Zie! hin; und es ist mehr als wahrscheinlich, daf in den kleineren Kreisen der Musik dasselbe Zielproblem gegenstandlich aufge,,:,orfen wird, das den Gesamtprozef der Geschichtssymphonie, tiefer noch: der Geschichtsphilosophie der Ethik der Innerlichkeit bewegt. Der Zug der groBen Musiker in ein scelischcs Gehiiuse, in die ihnen zugeborene Ichgegend, in den zu sich selbst gefarbten, angehaltenen, aufgebrochenen, zu geheimster Stube ertonenden, dahingestclltcn Augenblick des integral en Selberseins, als dem Ding an sich auch der Musik - ist sclber nichts anderes als der Gang ihrer Zeit in ihren Raum, und derart ein Umschlag ihrer spezifischen Zeitform in ihre spezifische Raurnform; wonach sich im Weiteren der letzte noch iiber dem Wegtempo liegende Geist des Fugen- und Sonatenrhythmus als der Geist der Hierarchien, Subjekt zu haben, transzendierend kontrapunktisch beziehen laBt.
Das Bachsche und das Beethovensche Kontrapunktieren
als Form und beginnendes Idiogramm
Denn wenn wir nicht mitgehen, geht iiberhaupt kein Ton.
Er kann zwar fiir sich einige kurze Schritte tun. Aber diese sind bald zu Ende, der Quintfall bringt alles sogleich wieder zur konsonanten Ruhe. N ur die Tonleiter fiihrt weiter, und diese ist bereits ein rein menschliches Gebilde.
Nichts ist Freilich leichter, als in ihr nun einen melodischen Einfall zu haben. Fast jeder kraflige Takt, schon die schlagenden Rader und Gerausche des Eisenbahnwagens ziehen ihn sich nacho Es wird sehr viel seltener, auf einen bewegungszeugen-
124
dell. melismatischen Einfall zu stolsen, und wie die ersten Singstunden schlechter singen lassen, so dampfl das sich Ausbreiten diescs Einfalls in vielen Stimrnen, das keineswegs »schon- fugal zu sein braucht, sondern sich auch mit kammermusikalischer Fcinheit begniigen mag, zunachst allen melismatischen Glanz ab, U111 den unechten zu vernichten und dafiir den echten ins rechtc Feuer zu setzen.
Hat nun dieses mit uns anhebende, sich gewaltsam zusamrnenwebcnde Beginnen Tiefe? Es entsteht hier ein Anderes als Tone, die frei, einreihig und liedhaf!: spielen. Das Melos steht auf, das Thema rcgiert, die Durchfiihrung, der schopferische Dcctbovensche Ausbruch iiber dem Thema, mit dern dieses zur bloGen Gelegenheit und nicht zur einzigen Betriebskraf!: wird. So licgt, sofern er nicht Mittel, Formel, sondern Form ist, den mannigfaltigen Arten des K ontrapunkts die letzte transzendiercnde Beziehung der Musik zur Last. Er ist es, harmonisch angcfeuert, von dessen bildenden Kraflen alles enrspringt: er geschicht, und das Grofie hebr an, man kann die Aste und Zweige auseinanderbiegen und sicht nun, woher, aus welchem Gestr iipp sich die Bliiten des wundersamen Baumes zur Krone zusammengcfiigt haben. Aber wenn es noch nicht einrnal so steht, dOlE Schwefcl, Phosphor und Reibflache die Flamme erklaren, wie sollte es da gar einen Newton dieses Grashalms, dieses Organischen hochsrer Ordnung geben? Auch hier noch ist der Mensch, der gebraucht, das Wesen Bach, Beethoven, das sich bedicnt, das direkte MaB aller Dinge und selbst noch des wenizstens indirekt transzendierenden Kontrapunkts.
Freilich hat man es noch kaum verstanden, was derart an glanz cndern Fluf und Warme kam. Man setzt ohne weiteres voraus, daB der Schuler nicht of!: in die Lage kommen wird, cine hge zu schreiben, aber man schlielit trotzdem mit ihr die Schule des Gewissens abo Das heiBt, ganz spurlos ist das metalEsche, instrumentenreiche neunzehnte Jahrhundert nicht an der Theorie voriibergegangen. Man hat ihm, weil seine hohe c, kkordische Leistung auf der Oberflache liegt, die Harmonielclire entnommen, die zwar zeitlich und auch in gewissem Sinn cntwicklungstechnisch tiber der Fuge steht, die aber doch, als GloBes einseitig betontes Spezifikum eines scheinbar nicht so kontrapunktischcn Jahrhunderts von Musik, dem alten Kontra-
125
punkt der Sphare nach den Vorrang lassen mufi. So bleibt, was die Son ate gebracht hat, die spezifisch sonatentechnische Enrwicklung, dennoch ohne Theorie. Es reicht nicht aus, hier blofi harmonisch zu erklaren, denn Beethoven ist keineswegs auf seine modulatorischen Riickungen und Kiinste zu vereidigen. Und was sollte es an der Apassionata sein, ja selbst an der fugierten Ouvertiire zur Weihe des Hauses, das sich mit neuer Harmonielehre bei altern Kontrapunkt erfassen lieBe? Das alles steht gerade harmonisch weit hinter Bach zuriick, der ein begrenztes Feld unendlich reich bestellre, und wenn Beethoven rhyrhmisdier harmonisiert, so ist der Deduktionsort dieser Rhythmik an einem anderen als dem Bachschen Kontrapunkt gelegen. Die Befreiung der Stimmen wie der Dissonanzen, das neue, zu groBen Hohepunkren hinreiBende akkordisch-kontrapunktische Spannungswesen, das Nacheinander und die thernatisch Zweiheit der Son ate wirken nach wie vor auBerhalb des alten, wenn auch nom so verbesserten Gradus ad Parnassum. Die Sonate stehr zwar anerkanntermaBen mit der Fuge in einer Reihe, aber wahrend die Fuge seit dem alten Fux unaufhorlidi auf ihre kontrapunktische Wiirde und Gesetz lichkeit gebracht worden ist, bleibt die Theorie der Senate im Erzahlungston der bloBen, auBerakademismen Formenlehre stehen, und der Aufbau ihrer Form, ihr eigener unentdeckter Kontrapunkt, wie er mit der rhyrhmischen Harmonie anhebt, untcrliegt sonatentheoretisch der Willkiir oder, was fast noch schlirnmer ist, der Diktatur des Programms als der fast durchaus musikfrernden Logik. So stehr die dynamische Theorie der Sonate weir hinter der reidi-statischen der Fuge zuriick und der bisher nur von ihr abstrahierten hoheren Mathesis des Musikalischen iiberhaupt. Es ist wichtig, bliihend und gefiillt, durchbrochen zu arbeiten, es ist ebenso sehr erforderlich, zuzeiten auBer auf die kammermusikalische, auch auf die alte dialineare Schreibweise zuriickzugehen, urn der in ihren Ausdrucksmitteln leicht ersdiopfbaren, problema tisch werdenden Harmonie neues Leben zuzufiihren. Aber Gesang, Begeisterung, Genie der Liebe, der neue Sturm, der riesenhaft schlagende Ozean Beethovenschen Musikgeistes sind nom wichtiger; und wenn die Stimmfiihrung der Sonate lodieriger geworden ist, wenn sie der Kultur des Einzelnen im Rausch des Ganzen noch ermangelt, so konnen
12.6
diese Fehler folgerichtig nichr mit dem aiten, sondern durchaus nur mit ihrem eigenen, spezi/ischen Konrrapunkt geheilt werden.
Dieser setzt nicht miteinander, sondern zerteilt den Klang und fiihrt ihn durch. Die Durchfiihrung kommt zwar auch schon in der Fuge vor, als die eigentliche Entwiddung der Srimmen, wobei jedoch das Thema einfach nur wandert. Es heginnt eine Stimrne, tragt kurz ihren Gedanken vor, eine zwcite Stirnrne setzt ein, das gehorte Thema in der Oberquinte oder Unterquarte zu imitieren, doch mit gewissen Riicksiditen auf die Wahrung der Tonart, deren wichtigste die gegenseitige Beantwortung von Tonika und von Dominante ist. W:1hrend des Vortrags der Antwort fahrt die erste Stimme mit einem zumeist sparer noch ausgenutzten Kontrapunkt fort; ist die Fuge dreistirnmig, so folgt die dritre Stimrne wieder mit dern Thema in seiner ersten Gestalt, dem Dux, und eine vierte nirnmt nun wieder die Antwort auf, den Comes, dergestalt, clall mit dem Augenblick, wo sich aile Stirnmen mit Dux und Comes cingefiihrt haben und so der Satz seine volle Stimrnenzah! erreicht hat, auch die erste Durchfiihrung beendet ist. Es konnen je nach der Ergiebigkeit des Themas noch vier oder fijnf Durchfiihrungen erfolgen, aile durch genaue Regeln bestimrnt, die den Stimmen jedesmal neue Kontrapunkte, reich auslegende Verflechtungen, erlauben, was nach Riemann jedoch nur insoweit gut ist, als dabei wenigstens charak teristische Motive wiederkehren, bis endlich die letzte Durchfiihrung, das Srrctro, das Mcisterstuck der Engfiihrung, das heiBt der kanonischen Ineinanderdrangungen von Dux und Comes erschcint, Selbstversrandlich ist das alles nur ad hoc zureichende Vcreinfadiung und erschopfl nicht einrnal das einfachste Schema dcr Bachschen Entfaltung, der - etwa in Kurths vorziiglicher Analyse Bachscher Dialinearik aufgezeigten - Durchdringung von Linienziigen. Aber immerhin, es gibt hier, in der Fuge, nur Eintritt und kein Ereignis, nur Geduld, aber keine Unruhe irn Einschlag: alles Oberraschende ist dem Thema, als welches dazu bestimmt ist, haufig wiederholt zu werden, ebenso frcmd, ja von Nachteil wie dem ununterbrochenen Gang der l:uge seiber. Denn sofern diese gehalten ist, alle Stirnmen zu beriicksimtigen, bewahrt sie eine gewisse rnittlere Linie oder
12.7
Ncutralitat, die daher auch im Harmonischen und Rhytrnisdicn eine gewisse Zahigkeit, Casurlosigkeit, Cravitat des Gehens und Flieliens bevorzugt. Die Fuge ist, so fluchthaft und reich sie innerlich ist, im Ganzen Ruhe, Gebautheit, Schichtung, ist, cum grano salis: mittelalterlicher Sozialgedanke in der Musik: sie ist auch nicht atemlose Entdeckung einer Wahrheit, sondern wie sorgfaltige Auslegung cines Dogmas. Erst in der Sonate also bricht das Wirre, Reiche, Barocke auch extern, als extern, als offene Gotik hervor; Freiheit, Person, Luzifer regieren in ihr,
nicht Jesus mit Fertig geschlossener Theokratie. Ganz anders .,., ..•.•.••.••••.. also klingt Beethoven, das Durchwollte, Durchdachte, der Griff •••
und Angriff tiberhaupt, und seine Durchfiihrung, tiber einer doppelthematischen Spannung sich erhebend, reiiSt hin zum Unbekannten, zur fremdartig bekannten Wiederkehr in ande-I rer Ebene. Hier erscheint, wie wir so haufig schon dargestellt .~ haben, das kraflige erste Thema, dem ein weicheres, gesangsmalliges zweires Thema gegeniibertrirr, regelrnaliig in anderer, aber verwandter Tonart, beides noch leer und unabgeschlossen. Allermeist wird der erste Auftritt wiederholt, worauf dann nach dem Doppelstrich der luftigere, geistigere, tonartlich aufgeregte, zerschlagende und wieder gegensatzlich zeugende Durchftihrungsteil erscheint (leicht beieinander wohnen die Gedanken); bunt, in reichen Modulationen, Bruchstticke beider Themen kombinierend und durch ihren Widerstreit mehr oder minder packende Steigerungen bewerkstelligend, aus denen schlieillich mit der Rtickkehr in die mit Vorbedacht gemiedene Haupttonart wieder die beiden Themen hervorgehen, aber das zweite Thema in seiner Cegensatzl ichkeit zum ersten gernildert durch Annahme oder moglichste Annaherung an dessen Tonart. Sofern gerade Beethoven der grollte Meister dieser Kunst ist und der erste Satz der Eroika ihr ewiges Muster, kann eben die Frage des sonatenhaften Bauplans vor all em auf das Problem des Neuen, Unverrnuteten, Produktiven, des zerstor enden, sich tiberkreuzenden, iibcrhohenden N acheinander
im Durchfuhrungsteil konzentriert werden, als welcher damit Iiir die gesamte zu bestimrnende Kontrapunktierkunst der Son ate iiberhaupt zu stehen hat.
In ihm treibt und erhitzt es sich, schraubt sich nach oben, der Zug wird gewaltsam. Das Blech klingt und prallt zusarnmen,
128
wilde Teilkrafle kreuzen sich, ein feuriger Atern !alit sie ergliihen. Vor all em ist dabei das blolle Auslegen, die rein ausle"cude Wand!ung von vornherein gegebener Themen aufgegeben. Nur das Eine besteht weiter, daf zurneist kein eigentlich ncucs Material zum Aufbau der Durchfiihrung herbeigeschafft wird, auller jenem, das bereits in der Exposition vorgekommen war. Dagegen herrscht in der Auswahl selbst volle Freiheit; dcr Kornponist ist weder einem einzclnen Thema als einem l:;1nZCn, mechanisch unteilbaren Gebilde noch gar allen Themen ~lcs Anfangs gcbunden verpflichter. Er kann sich auf blofse themar.sche Motivteile beschrankcn, ja es darf sogar der Leitfaden clef Tonalitat verlassen werden, sofern sich nur die aufgegebene Tonarr iiberhaupt wieder nach allen I rrungen hcrstellt, die gel11';me und am Ende siegreich hervorbrechende Zweckursache dcr gcsamten, nicht nur bewegungs-, sondern dramazeugenden 1 hrmonisierung. Vorgegeben ist das Thcrna also nur als jenes z wcifach thematische Trciben und Keimen, das sich fortzeugt und kinetisch werden mochte. Und es geht keinesfalls an, die Sache so darzustellen, als ob diescs Thema, ist es schon kein fC'lCS Gcbilde, nun wenigstens ruhende Spannung ware, die sp.irerc Kraft in sich aufgespeichert halt. Dann ware es Freilich Icieht zu loscn und fortzuschreiten, wenn auch nur mit dem lid. daiS sich das Gcspannte ohne jede neue Einzahlung, wie sic gcrade im Widerstreit der Themen liegt, wieder zur blofsen \ldodik zurUckbildete; cin Anblick, der bei den noch uneigentlichen. noch nicht zu sich gekommenen Mozartschen Sonaten .11L·rrlings haufig isr. Aber weder Beethoven noch Bruckner t10ch gar Wagner, bei dem das Thema nicht einmal am Anfang stchr, sondern nur wie ein fernher wirkendes Apriori dariibersteht. konnen Fiir diese blofse Uhrfeder- oder gespannte pfeilh(),~cntheorie der Thematik als Belege angefUhrt werden, und iiberdics gibt es das Thema im Finale fast durchgehends nur ais Produkt und nicht als tatsachliches Prius der Entwicklung, \i!cs h:ingt davon ab, was man mit dem Thema anfangt ; so wenig wie Jean Pauls vergntigtes Schulmeisterlein Wuz, das krill Geld zum Kaufen hat und sich deshalb selber aus den Titchngaben des Messekatalogs die Biicher zusammenschreiben mug. urn zu einer Bibliothek zu komrnen, - so wenig wie dieser absol ute Phanomenologe der Thematik dadurch erfahrt, wie es
129
mit der zeitgenossischen Literatur steht, so wenig ist das blolie krude Thema, mag es auch noch so gut erfunden, scharf umrissen und bewegungszeugend komponiert sein, ein Kern, aus dem von selber, oder auch im Bund mit anderen Kernen, der Wald der Symphonie erwachst, Dazu, dag man voran und ins Innere dringe, leistet das benutzte Akkordleben schon bessere Dienste, Und zwar nichr nur so, dag aus den Fi.illstimmen gewisse unwesentliche Nebenflusse entspringen, die sich in den auch ohnedies bestehenden Fortgang ergielsen. Sondern es gibt hier eine eigene formbildende Kraft, die die Tonreihe umstirnmt, umbildet, ja, fiir den Laien sogar unerkennbar machen kann; die unter einen ganz anderen Himmelsstrich fi.ihrt und derart vor allem irn Durchfiihrungsteil das Schweifende, Entfernte Entfremdete des Geschehens mitsamt der Sehnsucht nach der tonartlichen Heimkehr hcdist kraftig unterstreicht. Vorab eben hat sich bei Beethoven der Rhythrnus der Harmonie bemachtigt, kraftig treibende Dynamik eingebracht und ihre rhythmische Tonikakultur dariiber gestellt. Der Atem des Rhythrnus erlaubt nicht rnehr, daB sich die Stimmen nur akkordisch-vertikal ausgeben, gar homophon entspannen, so wenig wie er es ferner noch moglich macht, daf sich in allen Stimrnen eine einheitliche Oberzeugung im Sinn der reibungslosen fugalen Selbstdifferenzierung eines einzigen Gedankens vortragt. Sondern die Kraft, die rhythrnisicrt, baut in die Tiefe, sie reigt ein mehrstimmiges Geschehen dadurch an sich, daf sie die vertikalen Schnitte zusarnmenfallt, daf sie, ihrer Neigung zum durchbrochenen polyphonischen Geschehen unerachtct, die sich einschichtig klarenden Hohepunkte bevorzugt, die Stellen, an denen sich die Tone zu den tragenden Tonsaulen der errungenen Herrlichkeit zusammenfiigen und eben dadurch die abenteuerreidie, sich steig ern de, sich entscheidende, dynarnischrhythmische Harmonik in den Dienst einer neuen Form, der Kontrapunktik des Nacheinander, zu stellen verrnogen. Wobei eben dieses N achcinander erst im Ganzen wieder H orizontallsmus darstellt, einen, der sich haufig auf die Wende-, Durchgangs- oder Eckpunkte, vor allem aber auf die rhythrnisch betonten Haltepunkte der Harmonie prinzipieller angewiesen sieht als auf die entsdieidungslose Stimmigkeit des architektonischen Kontrapunktierens. Rhythrnisch bleibt auch die Ach-
130
tung auf den Akkord, auf seine fast stets geheim rnitwirkende, yon ihm unterstrichene rhythmisdie Dominante, nicht nur ein Zufalliges, das kontrapunktisch nebenher geschieht, sondern es wird ehrlicherweise zum Prius des Komponierens, das kammer.nusikalisch reiche Melodisieren gerat in die Mitre, und die orangendc Weigglut des Orchesters, das Prius der siegreichen, rhythmisch aufspannenden Harmonie, harmonisch untermalten Rhythmik wird derart am Ende sogar zu einern Prius nicht r u r des Standpunkts, sondern auch der Sadie, der von Beethoven bis Bruckner drarnatisch bewegten Sonatensache. Allerc1;n,~s, es ist letztbin auch nichr das zeugende Akkord- und 1'- hvthrnusleben, das die Sonate sich erweitern lagt. Denn die-
. k ann wohl das Neue kennzeichnen, vielleicht auch weit,;(.ilend untersriitzen, aber selbsr die noch so reichen Moglichk citcn dcr Dominantspannung und des rhythmisch befcuerten i\ k kordlebens sind nicht imstande, nur aus sich heraus die Einbriiche des Neuen, im Thema Ungesetzten und Ungeahnten, w;c cs hier zur Diskussion steht, zu deduzieren. WahrsdIeinlidI hringt dazu erst der Gegensatz in der Aufstellung der beiden Tlicmcn das entscbeiderule Moment; daB man also ins volle I nncre luziferischer Musik eindringe, dazu verhilfl erst die /c'ciprinzipienlehre der Son ate und jene den Gcgensarzen ab,'crungene Einheit, die sich als »Abstraktum- des Siegs gleidi,;,111 nur zufallig mit dem bloilen Wegzeichen des ersten Then131 dcck t,
Hier vollends schrauben sich die Tone nadi oben, sdilagen ["'ler, aber der gewaltsame Flug hat auch Halt. Es eritstcht iorttrcibend und sich steigernd ein Anderes, der Kampf oder die S['"le der sich herausgebarcnden Beziehung. Daher ist bei BeethOYCn das Einzelne nichts und das Leben im Zusammenhang ,,1lel, Kraft, Geradheit, konf1ikthafter Aufbruch und eine T cilung, die kein Besitz, sondern ausschlieBlich ein Gewinn ist. BeC'thoven kennt so in seinen Durdifiihrungen, seinen erst recht C'lt/\\'[>;rcn, nicht die Gelegenheit zum feinen, ruhigen, einsanWn Sichbereichern des Thernas, sondern allein das Pathos der V c]".\,ertung als die Tapferkeit, den Schwung einer in der eige:'en harmonisch-rhyrhrnischen Substanz gegebenen Geschichte. \f;1t1 tr itr bei Beethoven in das Zimmer und atmet die Beziehll'~g, man fLihlt auf das eindringlichste, wie sich hier alles
131
wechselnd komprimiert, und erlangt so gleichsam durch den wechselnden Lufl druck der Atrnosphare von der Hohe und Tiefe des Gelandes Kenntnis, mehr noch, man erlangt jene wahre Seernannsintuition, auch genetische Intuition filr Atmospharisches und seine Gesetze. Wie hier aus einem rasch vergangcnen Tonfall oder an einem schcinbaren Endpunkt ein winziges Gebilde hervorwachst, fast unsichtbar noch und ohne Bedeutung, wie es aber stark wird, Freunde wirbt, mit dem Alren den Kampf aufnirnmt und bald die gcsamtc Situation mit machtigcn Gliedern, mit alles beherrschender Erfiillung tiberwachst, Es ist Auftrieb, Ermattung und Ungltick, Verlorengehen, Argument und Sieghaftigkeit in diescr Musik, dicht hintercinandcr oder in grofsen Zi.igen gegeben, so sehr, daf bei Beethoven aile Springbocke und Hebebaume, die scheinbar allein die rhythmische Harmonic angesetzt hat, vor diesem seinen wiitend entzweiten Inneren und der am Gegendruck des Fremden sich objcktiv entfaltenden zwei Prinzipicnfruchtbarkeit ~b~rfli.issig werden. Er hangt die Knospen i.iber die Lampe, darnit SIC s~hneller reifen, wie ja selbst die bekannten Adagioblumen zwischen zwei Abgriindcn bci diesem so wenig pflanzenhaften Meister niemals sehr nati.irlich aussehen. Daher spricht .Bcethoven auch nicht unbefangen im Adagio oder im Cantabile der Variationen, in seinem langsamen, eigenti.imlidt bes~hwerten, agitatorisch schmachtenden Satz, sondern wei taus typischcr und allein definierbar im Beginn und im Finale dort wo es sich urn die sthenischen Affekte und urn die gew~ltige~ Ansammlungen seiner in den Menschen hineingehenden Strategic handclt, Er ist schon durch die Geringfi.igi~keit seiner Themen, d.ie fast insgesamt nur als die to~karg~n Zeugen eines dynarnischen Zustands gesetzt sind, dazu gezwungen, ein Neues im Fortgang zu schaffen, ein Anderes als die blofse Entv:icklung, Auswicklung oder rein architektonisdi kontrapunkticrte Abwandlung des gleichartigen Thernas. Auch bei Bruckner, obwohl er Beethoven in der Liebe, Ausftihrlichkeit und Frfindungskraft des chromatisch Melismatischen in und tiber dem Thema iibertrifft, liegt das Steigernde weder in den Themen angelegt, noch auch, wie wir sahen, abschliefsend in der nachthematisch gesetzten Harmonik und Rhythrnik: sondern jcnes Andere, der Symphonic Ureigene ist heraufgezogen, das
1)2
noch keinen Namen hat, wenn es sich auch ungefahr mit dem bczichungsreichen Nacheinander oder mit dem Wirken eines nicht mehr architektonisdien, sondern dramatischen Kontrapunkts umschreiben laBt. Es ist ein gewaltiges, mehrsatzig ausgcbildetes, zyklisches Breiterwerden, das ebensowohl die bishcrige Dominantspannung weniger Takte zu einem ganzen S~1tZ ausdehnt, also lotrecht gesehen, einen ungeheuren Vertihal ismus schafft, wie es andererseirs die hintereinander gejagten Themen zum Nacheinander und nur mehr erinnerungsmaGig fcsthaltbaren Nebeneinander, Ubereinander im Zusammcnhang cines ganzen Schicksals in Musik verwandelt: zu ciner ncucn, rein gedanklichen Waagrechten des Kr afleausgleichs, zu ci ncm erst im Ganzen der dynamisch-dramatischen Einheit -icbtbarcn Horizontalismus von Blitzen, breiten Feuersbri.instCI1, verzauberten Riesenworten, Magic des Marsches und uners.ittlich weitern Triumphgelande. Die Symphonie ist Klang, dcr sich erst bildet; ihre Form ist Unruhe, Zerstorung, Uberhohung, dauernde Visierung noch ohne verweilende, absolute Vision; ihr Kontrapunkt setzt nicht linea contra lineam, sontkrn complcxum contra complexum und sewiihrt erst in diescm behaltcnen, »historischen« Horizontalismus das Zugleich, das Insgcsarnt, die emporgetragene Gestalt.
Dazu also mufsten die Stimmen zunachst leichter werden oft auch pausieren, urn in Schwung zu kommen und zu hleiben, Scitdem aber hat sich der Ton wieder gefiillt, ist sangvoller lind durchbrochener geworden. Ein schwieriges, neues Zugleich: (hs organisch ineinander gewobene Saitenspiel und das gewaltS;:tmc symphonische Feuer mit Ermattungen, Hohepunkten und dcm Geist der Zukunft. Was jedoch Schubert begonnen hatte, cbs haben Bruckner und die Wagnersche Polyphonic weitcrgefuhrt, und ein bisweilen schrnaler, klangloser, rein dem Betrieb E',rgcbcner melismatisch nur gepunk teter Tongebraudi in der becthovcnschen Symphonie ist gerade als das Unwesentlichsre ~nd leiditest Eliminierbar e an ihr erkennbar geworden. SeirGC.m konnte alles wieder redite Hand im Klavierspiel, und alles wiedcr Einzelnes, reich erbliihende Solostelle im orchestralen Zusammenspiel werden. Es hat sich gewissermaBen herausgesrellt, daB es ein Selbstverstandlidies, cine kammermusikalische Fcinheit, ein kontrapunktisches Minimum gibt, das noch unter-
I33
halb der Fuge liegt, die nur cine seiner m6glichen Formen darstellt, Diese Feinheit ist dauernd nur ein Mittel, dauernd nut cine chiffernlose, nichts bcdeutende, reflexive Formel, genauso wie es die gesamte Harmonielehre war, aber die einzelnen spezifischen Arten ihres Uberbaus bilden entsprechend der Rhythmik eine gegenstandsbestimmende Form. Macht man jcdodi den fugalen Gebrauch unbedingt, unterschlagt man alles, was die Sonate auBerdem an Nacheinander, an bedeutsamer Konkurrenz des Harmonischen mit dem Kontrapunktischeri, gar an Kontrapunkt der dramatischen Harmonie gebracht hat, dann wird davor auch der Kontrapunkt der Fuge reflexiv: als fur alles und darum fur nichts, nicht einmal mehr fiir sich geltend, als eine aus eincr einzigen seiner Konkretheiten abgezogene und darum farblos gewordene bloBe Geschiddichkeit, der gerade der transzendierende Valeurwert im wohlgesammelten System der Kontrapunkte abhanden gekommen ist. Wenn daher die bewegliche und doch gleichmafsige, durchsichtige Anteilnahme der Stirnmen wieder gekommen ist, wenn vor allem Bruckner wieder melismatisch vielfaltig spielen laBt und aile iibrigen Zeichen darauf hindeutcn, daf die Musik einem stetig hohercn Grad von Durchbrochcnhcit, neuer Durchgcschnitztheit und innerer Machtigkeit entgegengeht, so legt dieses nicht auch zugleich eine kopistische Riickkehr zurn Kanon nahe, als ob sich Haydn aus Handcls Brokat cin bloBes Hausgewand zurechtgemacht hatte, a ls ob Mozart aus dem Bachschen Baroek zum leichten Rokoko und Beethoven zum kahlen Empire abgefallen waren, als ob schliclilich Bruckners und Wagners polyphoner Syrnphoniestil den alten architektonischen Kontrapunkt zugunsten cines kleinen Kunstgewerbes urn ihr illegitimes Dramatisieren herum abgebrochen hatren. Sogar die andere Forderung, daB die Iet zte Musik zu dem melismatischkontrapunktischen Gleichgewicht der Fuge eine Realisierungsbeziehung, die Beziehung der Wirklichkeit zum Korrektiv aufweisen wird, bedeutet kein Oberschlagen der dynamischen Senate, kein » Vorwarts zur Fugc«. Sondern: der hisrorisdie Beethoven steht dem »realen« Bach naher als der historisdie Bach, die allmahliche Ubereinstimmung mit der alren Musik des Raums ist ein acte accessoire, ein griindlidies Beethovensches Arbeitsergebnis, ein rein substantieller, das vollendete
134
System bekronender Gnadenakt, und so bleibr der gesamte d~amatische K ontra punkt als Bereitungsort auch vor die letzte Musik, vor die Ontologie der Musik iiberhaupt gclegt.
Nun freilich hort das Ohr auch hier mehr, als der Begriff erk l.iren kann. Oder anders gesagt, man fiihlt alles und weif ge- 11:, u, woran man ist, aber das Licht, das im Herzen brennt, erliseht. wenn es in den Verstand gebracht wird. Deshalb also mug, urn das kontrapunktisch Intendierte recht zu verstehcn, tiber den Kontrapunkten als bloBer andeutender form ein ncucs Ich, das zuhorend erlebte, das die Kontrapunkte gebrauchcnde Ich der groBen Musiker seIber als eigentlich expressivdcskriptives Siegel, ja sogar als beginnend abstandsloses Idiogramm eingesetzt werdcn, Es ist nicht moglich, hier etwas rein '. crsrandig zu erklaren und dann unmittelbar hiniiber zu beziehen. DaB das Spiel geordnet zugeht, ist gewiB, aber doch nicht dicscs. was der bcdilrfligc Mensch daran, dahinter sucht. So w: rei ctwa behauptet, daf Beethoven die Gewichte der erganzcndcn Themen mit gr6Berem Verstand als Mozart einhangt, Das aber reicht ersichtlich nicht aus, urn das geh6rte, das bunteste Geschehen zu crklareri: es ist nicht nur besser, wenn Beethoven irrt, als wenn ein Theoretiker Recht hat, sondern auch dieses, worin Beethoven strenge und weise ist, lagt sich letzthin nicht nach dem Komrapunkt als Form, auch nicht nach dem zwcitcn bleidoskopischen Kontrapunkt des Nacheinander, als Scrcnge und Weisheit reflektieren. Nicht minder durfte das form.ll. 'das hei{l,t hier stets, auch das der Form nach Gegebene ycr\,lgen, wenn cs gilt, nicht nur das Woher, das zur Not noch :1\IS der kontraren Reibung und Lauterung der Themen »erkl:lrt« werden karin, sondern das Wohin, den Sturm zu deduz icrcr, in dem diese Musik dahinfliegt, das Wozu und Worauf clcI Srurrns und namenlosen Kampfes, das tiefere Wieso und \'('a, des Begltickenden im Gewinn und aile die iibrigen geistj:'_'hcn Kr.ifle dieses der formal en Chiffer nach so diirftigen und 7ie11osen Spiels. Gewif] also ist alles wohlgeordnet, es ist genau s(lyiel »Mathernatisches« wie Ordnung darin, und gewif lassen ,idl insofern die Arten des Kontrapunkts gleich den Bezugs-, :'\\1fbau- und Ordnungssystemen der Tafel, des Festes, des Tan- 7:', der Strategie, der Funktionslehre, der Systematisation insge,amt in einer Ordnungslehre entwickeln: aber das Wesen
135
Musik wird durch solches so wenig und noch weniger erschopfl als Logik und Kategorienlehre die Metaphysik wiedergeben. Denn was man am Geriist ersieht, so ist das die Dorfbiihne, auf der Garrick den Hamlet spielt, oder genauer: Bach und Beethoven, die gebrauchenden groften Subjekte selber erscheinen iiber der Form, der andeutenden Chiffer, der bloE unteren Gegenstandsbestimmtheit als rufende, schaff en de, expressiv-deskriptive Siegel, ja eben, da hier die Nadel sich wic in der Nahe des Pols senkt, als beginnend abstandslose Idiogramme, als Standindexe der musikalischen Metaphysik der Inwendigkeit.
So wenig umfalit die blofse Satzanlage dieses, was der ergriffene Horer ohne weiteres kennt und begreift: den Spiegelsaal und die Caste der Musik, dieses Theater der Zaubereien und Illusionen : und selbsr die tieferen Formen des Kontrapunkts bleiben ohne den neuen, autogenen, methaphysischen Einsatz cines das Baehsehe oder Bcethovensche Wesen wciterbctrcibcnden Subjekts blofse hohere Zahlenstufen von Mechanismus. als welche keineswegs zur Fuge oder Senate im Stand der I dee kontinuierlich iiberfiihren konnen, Bach und Beethoven also ~~: sind es allein, die letzthin als transzendierender Kontrapunkt,u existieren: Bach und Beethoven allcin und dasjenige in unse- !
rder RZezeptivditat, dads BachbulndbBeethovlen antworten kann, als".'.I.·,.i! .•• ·,
em eugen en un Una eit aren, a s der lebendigen Kraft, "
vcrrnoge derer all dieses geschieht, als dem einzig wescntlichen " Halt diskontinuierlicher Musiktheorie, als der groEen Begeg-& nung einer besrirnrnren, zu ihrer Sphare hinzwingenden Sub- \l jekthaftigkeit und als dem Baeh oder Beethoven benanntcn In- ' •. ii I' dividuum, das an Orr und geschichtsphilosophischer Stelle so ,~' allgemein und kanonisch ist, daE es gleieh den Engeln Plotins'~ I als die wirkende Kategorie dieser einzig moglidien transzen- il dierenden Kontrapunktik stehen kann.1 Es gibt derart vier groEe Weisen, Kontrapunkt zu haben, und '.'~ .. ~,.·,i.· .•. aile diese besitzen an Ort und Stelle eine gegenstandlidie Be- i ziehung zu erhischen Tatbestanden. Nun wurde allerdings gerade der Musik einc ausgepragt geschichtlich exzentrische Rolle angewiesen. Aber sie ist ja gerade nur deswegen nicht historisch konform, weil ihre bislang kurze, spat eintretende Geschichte
die Geschichte unseres Kerns wiederholt, weil, mit anderen Worten, die Geschichte der neuen Musik, als der »nachgehol-
tcn « M usik iibcrhaupt, zu groE ist fUr den Raum der N euzeit, und demgemali, wie bereits wah rend der Darstellung der Rhythmik zu sehen war, die ausgepragte geschichtliche Exzentrizitat dieser Kunst in dem Ganzen ihrer karegoriellen Wiedcrbolung von Geschichtsphilosophie und Ethik der Innerlichkeir begrundet liegt. Es gibt also vier groEe Hierarchien, Kontr;tpunkt zu haben, und diese besitzen eine konstitutive, wennglcidl zuhorend, sch6pferisch zu erganzende, also nieht einfach dir'ikte und sprunglos demonstrierbare Beziehung zu den metaphysisch-ethischen Ichspharen, Danach ist Mozart griechiseh, ~~;ht das kleine weltliche Ieh, leicht, ist der attische Kontrapunkt, die heidnische Freude, die sich bewufsre oder Gefuhlsseele, die spielforrnige Stufe des leh. Bach ist mitrelalterlicli, gibr das klcine geistliche Ich, kraftig und heilig gesehlossen aufgebJut, ci n Rubinglas von Musik, der archirekronische Kontrapunk t; erfiillt von der Liebe und Hoffnung, von der sich erinncrndcn oder eigcntlichen Iehseele, von der geslihnten Seele Ad.uns, mithin die glaubcnsforrnige Stufe des Ieh. Beethoven, W;tgner sind dagegen ausgebrochen, beschworend, fiihren in das grofte ioeltluhe, Iuziferische feh, sucherisch, aufstandig, trostlos an allern Gegebenen, voll von kampferischen Ahnungen eines hoheren Lebens, unterwegs auf einem namenlosen Entdcckungszug, noch ohne deutliche Beute: sie sind die Meister des dr amatischen Konrrapunkts und des Sturms auf den innerrn, letzten Himmel. Aber das, was noch aussteht, das groBe gcistliche Ieh, die oberen Srufen des Menschseins, die vollig angcbngte Musik wird die Kunst der spatcren Rcichszeit sein; und das sprach- und sieggekronte Angekommensein dieser unvor stcl lbaren Musik wiir de den Kontrapunkt des Nacheinantier 7.U der Gleichzeitigkeit einer Aussage, einer verstandenen, im glcichen Griff bcsitzbaren Satzbedeutung, einer musikalisch i!l)crdcutlichen Propherensprache a se, einem wirklich redenden Sinn Musik zu verdichten haben.
'Jochmals der Ton: nicht als Mittel, sondern als Phanomenale \Vl'lln wir also nicht mitgehen, kann nichts langer singen,
DaR ein Ton Folgen hat, dencn nachgegeben werden muB, ist durchaus nicht in ihrn selbst begriindet. DaB es auszuhorchcn
I37
gilt, wohin der Satz sich wenden rnochte, wie lange er das Bediirfnis hat zu fallen und wo der Punkt ist, an dem er sich aufrafft, urn emporzusteigen, das alles ware gar nidir moglich ohne eingefiihltc, kraflig bctatigte Willensspannung, die bchalt, mitzieht und eben die Foigen die tonend noch gar nicht da sind, vorwegnimmt,
Zwar auch der Ton an sich leiter sich fort und baut sich in verwandten Schwingungen auf. Er erregt in dem obertonreichen Glockenklang sogar entlegcne Akkorde und in jedem anderen angeschlagenen Ton mindestens die drei Teiltone des Durdreiklangs. Der Ton drangt dergestalt von sich aus weiter und besitzt eine urspriingliche Bewegung, die nach bestimrntcn anderen Tonen mit Kadenzzwang hingreift. Er verjiingr sich, schlagt Briicken, schliefh Quintverwandtschaften und setzt sich seiber, sofern er den Weg der Oktave, Quinte, Tcrz, also den Weg der ersten Melodic beschreitet, gewisse Punkte in der Harmonic, zu den en es ihn, ganz unabhangig von unserem Wohlgefallen, rein zahlenmaBig hinzieht.
Aber das ist nun freilich ein karges Singen, das bald wieder erlischt, Es ist das Singen der Basse bei festgehaltenem Grundton, ein Zug und Fall wesentlich von rein en Quinten, der dissonante Reichtum Fehlr, Ist der Ton einmal bei der Tonika angelangt, so bleibt er stehen; der Quintfall ist zu kurz, die Tonika ist ein Becken und ihr Konsonantsein mehr das Grab als der SchoB der Musik. So wiirde es iiberhaupt nicht eigentlich weitergehen, wenn nur die natiirliche Akkordfolge herrschte, wenn es keine neuen Leittone, Tonleitern, Vorhalte, Vorausnahmen, Bruchstiicke fremder Richtung gabe, die zwischendurch gehort und sogleich intentional weiter verfolgt werden. Entschcidend ist hier letzthin al1ein das tonleiterliche Denken, das den Zwang des Quintenzirkels lost und derart sowohl das gewollt akkordische wie das befreit kontrapunktische Wesen setzt, Gewig also, was gegeben isr, rnuf benutzt werden; auch kann man zugeben, daB uns der summcnde Tcckcsscl und der Sturm im Rauchfang an sich schon so etwas wie eine wundersame Geistersprache vernchmcn lassen. Und ebenso bleibt bemerkenswert, daf der Reiz der einfachen dreiklanghaften Urtatsachen sehr oft von Marschner, Beethoven und Strauf mit grolsern melodischen Gliick benutzt worden ist, aber doch eben nur ais
138
F.ohstoff, der an sich vollig nichtssagend, aulicrmusikhafl ist, uu d dem gegeniiber schon die sprengende Melodie dcr Tonleiter, die siamesisch dreizehn und europaisch sieben Tone hat, cin rein mcnschliches, unphysiologisches und erst recht unphysikalisches C,'bdde darstellt,
5,) wenig mag hier also ohne unsere fruchtbar vergewaltigenden Hiinde am Ton und seinen verwandten Schwingungen geIi ngcn. Er ist, urn musikhaft zu werden, schlechthin auf das Blut dc" Aufnehmenden und Ausiibenden angewiesen, gleich den SelJa ncngcbilden, die dem Odysseus Rede gestanden haben: nicht tiber sich, sondern iiber den Fragenden seiber. Die Weite .11:fT moglichen Teiltone oder der gesprengten Tonalitat, in wckhc sich die neue Musik wieder hinauswagt, ist gut und v erm,l~~ .lcm erschopflen romantischen, ja selbst Bachschen System 'll"l1C J mpulse zuzufuhren: aber jede sogenannte asthctische Tonphvsik blcibt ode ohne eine neue Ton-Merapsychik, der sic dicnt. Dcrart ist schlielilich, gerade wahrcnd cr gespielt wird, das Leben des Tons und seine eigene Bestimmtheit, sein mittelli.ulcr, ungebrochener Materialgedanke niemals wesentlich gerncnt. Das ist etwas, was, bisher wenigstens, malerisch und bildnerisch nicht entfernt im gleichen Mage erschien. Denn gelade weil das Sehen und das Lichthafte nicht den Leib des LetzTell liildct, wird hier auch das Stoffliche weniger aufgegeben. Es erschcint, als entfernter begleitend, deshalb auch treuer wieder, nur ctwa zu Holz gebrochen oder als ein durchbrochen, waIdl11'\l;ig Lichthaftes oder sonstwie noch leise naturhaft rezipiert. ri1c:cgcn gcrade weil die Musik n iher, tiefer anlangt, rezipiert si·,' den Ton, den total gebrochenen Ton auch tiefer als Stoff des \Vcscns Musik iiberhaupt: und muB deshalb, eben aus Grunden dcr tieferen Beziehung zum durchseelten Ton, zum Ton des Scclenhaften, den physischen Ton, jeden Rest am blolsen [iir ,ic} t.irigcn Mittel desto entschiedener aufgeben. Wahrend also Meister Erwin nur deshalb, weil er eigentlich in Holz denkt, d c Srcine des Strafiburger Miinstcrs aufgibt (gewiG nicht nur cbtLllb, denn warum dcnkt der Gotiker in Holz, nachdem er ;n Stein baut? aber eben, indem er immerhin zum noch physi'<he:] Holz zuriickgreift und ihm treu bleibt, weicht er der Sch~irfe der Entscheidung aus), - ist bei dem Beethoven der bDm-Sonate oder der Diabelli-Variationen die prastabilierte
139
Harmonie zwischen Erlebnis, Material und etwa allein darin erzeugter und getroffener Dingrnaterialirar ernstlich gestort, Man hat oft von der Askese des Beethovenschen Klaviersatzes gesprochen, und es ist bezeichnend, daB Bulow, der so oft Beethovens »akustische ScheuBlichkeiten« zu mildern sudit, gerade von dcm Altcrswerk der Variationcn als den »erhabcnsten Evolutionen des musikalischen Denkens und der Klangphantasie« spricht, Es ist nichr gam unrichtig, wenn Bekker bemerkt, daB die b-Dur-Sonate und die Diabelli-Variationen letzthin unspielbar sind, als fur ein Instrument geschrieben, das niemals cxistiert hat und niemals existicren wird, daB diese beiden Werke nichr mit dem realen Klang, sondern mit korperlosen, rein gehirnmagigen Klangabstraktionen arbeiten, urn sich der Klaviersprache nur als eines ungefahren, prinzipiell skizzenhaften Schriftzeichens zu bedienen. So dunn also auch der Ton schon an weltlicher Fiille ist, an der Kraft, die Formen einer breiten und vielgestaltigen auBeren Welt in sich aufzunehmen, so begrenzt bleibt auch das tiefere Vermogcn dieses iiberwicgend kiinsrlichcn Produkts, mit den Werken seiner eigengesetzlichen Bestimmtheit vor den Thron des inneren, rein innerlich erleuchtenden musikalischen Gottes zu treten. Man stcllt sich ein, man tragt sich heriiber, man dreht den Klang zum Spiegel und den Boden zurn Gebalk, aber nur so, dag das alles in uns lebt und durch den Ton lediglich angeregt wird, daf wir also vie I zu grogmutig sind, wenn wir den Spiegel kiissen, der uns doch nur mit unserem eigenen Bilde iiberrascht ; _ und nicht etwa in der Weise, als ob das eigene, bedeutsarne Bewegtsein an dem Ton »ernpfiihlt«, hcrausgefuhlr ware: als etwas, das mit unserem Horen vielleicht erst erwacht ware, das aber nunmehr, nachdem es erwacht, von uns verdichtet und mit Qualitar umsponnen ist, als das Praludiurn einer aufsermenschlichen Tonphysik oder Tonmetaphysik selbsrandig bestiinde. Das ist schon deshalb nidit zu erwarten, weil sich die auBeren Mittel steigend zu versdilicllen und zunichte zu werden beginnen. Sidierlich, wie hier endgiilrig besprechbar wird, ist es nicht zufallig, daf gerade der Ton, wohlverstanden, der von Menschen gebrauchre, radikal umgebrochene Ton, musikalisch einschlagt, daB gerade dieser zarte, durchsichtige Leib zurn Trager musikalischer Zustande erwahlt wird. Denn wer sehr ergriffen
ist, dcm gehen die Augen iiber. Er wiinschr sich .das Dunkel, den Abend herbei, es ist ein Zwielicht urn alles Tiefere 111 heir Es flicht den Tag, sein Erscheinen ist als Wehendes, Ge ell~es, Summendes dem unsichtigen Wetter gi.instiger gestimmt. Nicht anders wie die Geisterrufe und Geistererschcinungen uberha~pt die Dunkelheit der Nacht erwarten, in der das sonderbare inncrc Traumwerk ungestorr zu gehen und zu schlagen verm~g. Aber der andersartige Zauber der Musik lost diese Depotenzierun" des Gesichts ins Cunstige, uns Naheliegende, in den leuchtClldcren Sinn des an sich so unheimlichen Begriffs eines Geisicrrciches auf. So laBt Shakespeare im Si.iden sagen: »Wie suB clas Mondlicht auf dem Hugel schlaft! Hier sitzen wir und lassen die Musik zum Ohre schlupfen: sanfle Stille und Nacht, sie wcr den Tasten suger Harmonie.« Doch bleibt sie Todeszauber, die Musi]e, und ossianischem Wesen noch tiefer benachbart, dcm Rcvcn Herbst und der tie fen Freudigkeit des fruh hereinbrecI}~';l1i;n Dunkels, dem truben Himmel und den schweren Wolken dem Nebel und den Heiden, die auf der einsamen Heide rcil:'n und dencn die Geister in Wolken gestalt erscheinen, nicht «n dcr« wie sie Bach und Wag-ncr erschienen sind - der Himmd'richtung zugewendet, in der diese Welt ausgeht und unt.erI(l'ht. Wagners und Schopenhauers Theorie des Geisterseh:ns ('chen den Schliissel dazu: wie hinter allen Traurnen noch erne :\rt des innerstcn Wahrtraums lebe, die mit ciner Umflorung lb Gesichts anhebt und derart im fernsten Hintergrund der inucr en Traumwelt die Erscheinung der Ceisrcrgcstalten ermidicht. Wir seien nicht irnstande, das hier Geschaute dem Erwichcn und erwachten Bewulitsein anders als verrnittelst eines zweiten Traums zu iiberliefern, welcher den wahrhaftigen Inh,llt des crsten nur in allegorischer Form verrnitteln kann, weil hie- heim vorbereiteten und endlich vor sich gehenden vollen r rwachen des Gehirns nach augen bereirs die Formen der Erkenntnis der Erscheinungswelt nach Raum und Zeit in Anw~ndune eebrachr werden mi.issen, woraus dann selbsrverstandlich (':n d~ gcmeinsamcn Erfahrungen des Lebens durchaus verwandtes Bild resultiere. ]edoch bereits die grog en Dichter und S11akespeare voran hatten genau dort, wie die eingehiilltere Khngwelt in die offenbarere, aber niedrigere Lichtwclt iibcrgeht,'ihre bunt erleuchtete Bi.ihne aufgeschlagen; und erst recht
141
sei es derselbe Traum, der hier Shakespearesche Geistergestalten erzeugt, wie sie durch das vollige Wachwerden des inneren Musikorgans zum Ertonen gebracht werden konnten, und dort Beethovensche Syrnphonien, die ebenso das entschleierre, weniger somnambul umflorte Gesicht des Horers unfehlbar zum ~eutlichen Gewahren jener Gestalten, der dichten, unvergeBlichen, iiberrealen Ceistergestalren der grofsen Poetik begeistem miillten. Nur muf hier zwischen Traum und Traum unterscbieden werden: der cine sinkt herab und gibt lediglich eine abgeleitete, cine Mondscheinlandschafl: der Tagesinhalte, ein blolses sich Erinneru dessen, was schon war; und der andere ziebt binfiber, ist ein Dammern, ein am Klangsubjekt, schlieBlich ontologischen Wonsubstrat allernachsr geschehendes noch nicht bewu/ltes \Vissen dessen, was sich dereinst, driiben, im noch ungeschehcncn Driiben zutragr ; Freilich so, daB auch hier ein Wiedererinnern, ein sich Zuriickfinden in die Heirnat wirksam ist aber eben in cine Heimat, in der man noch niemals war und die dennoch Heirnar ist. Dcr Leib aber diescs letzten Traums mitten in der Nachr ist allemal von Gold, ist Ton, Goldton; denn gleich dem bedeutenden Menschen, der mehr Fehler als die ander en macht, weil er niemals ganz ermessen kann, wie unbedcutend, ihm unhomogen die Welt ist, kann auch der letzte Gott, das Wehen des letzten Cortes, in keinen Rahmen bloBer Sichtbarkeit und Bildhafl:igkeit, Materialwcrtigkeit mehr eingehen. Hafl:et die Farbc noch sehr stark am Ding und kann deshalb mit dicsem nichtssagcnd, von scincm Geist cntleert werden: so schaumt beim tonenden Erz das Klirren und Tonen tiber und bleibt nichr das Mcrkmal des Erzes, sondern hebt sich als neues, menschenhafles Attribut heraus; dergestalt, daB die Mittel des sich Horens und Vernehmens schliefllid; dem Ge~st naher. stehcn als Farbe und Stein oder das fragwiirdige Heimweh dieser unkategoriell gewordenen Materie nach Gott. Man kann sagen, die Musik verherrlicht seit alters die andere Wahrheit, die pia fraus, die konstitutive Phantasic, die neue Philosophie unter den Kiinsren. Nur der Ton, dieses Ratsel der Sinnlichkeit, ist unbeladen genug von der Welt, sie zureichend phanornenal [iirs Ende, urn als ein - gleich dem metaphysischen Wort - letzres materiales Erfiilluno-smoment des mvstischcn sich Vernchmens wiederzukehren; "rein auf den 601d-
142
)'nlnd der rezeptiven Menschenlatenz aufgetragen. Das kann un.l 5011 also durchaus nicht heifien, daf der nati.irliche Ton an sich schon ein metaphysischer Teil ware oder auch nur cine seelische Enklave in der Natur; aber die Beziehung bleibt insofern un'lbwcisbar, als das Horen des Tons, das sich in ihm Horen uru] Vernehmen, rnithin die Gebrauchsmoglidrkeit des Tons zu scil1cn ihm fremden, unphysischen Seclenkategorien allerdings ('ine j\hnlichkeit dieses Materials mit dem »Material « des unter Gorr Bedcuteten zu konstatieren erlaubt. Wenn man jedoch wcirgchend aus dern, was der Ton an sich ist und gibt, irgend ctwns fremdgcsctzlicher und astralischer Art ablesen will, so wi rd dicses zu einer unzulassigen Zuri.ickverlegung der Musik in die marhematische Naturwissenschafl:, wo sie so wenig vorzikornmen pflegt, als sich jemals in der Phanomenologie der musika lischen Wirkung ein rnathcmatisches Moment auffinden lidl,. Und darum fiihrt auch von dem reingemachten Ton, im Sinn seiner Oberwindung durch Grad, MaB und Quantum, wie cs cinern physikalischen, ja sclbst noch einern psychologischen Ccrrcnstand ziemt, niemals ein Weg zu dem geiaollten und r/'!{'ikhaffen Ton, zu dem rein akustisch vollig Unhaltbaren rcn.pcr icrter Stirnmung, enharmonischer Modulation, verrniedellcr cndloser Chaotik; zu der Spannung seiner Melodie, der dissonanten Buntheir seiner Harmonie, der willenshafl:en Pra,~mI1Z seiner Thematik; zu dem vielfachen, menschenhafl:en, durchbrochenen, zeitraumhafl:en Hintcreinander, Obereinander OCS Kontrapunkts, als des ki.instlichsten Gebildes der Welt; zu d',')1: dcnaturalisierten Ton als einern fast schon rein merapsychidwn Gegenstand und ersten Phanomenale aller Heimlichkeit. Trotzelem aber scheute man sich nicht, den Ton nur ganz auGen !anden zu lassen. Es ist noch nicht so lange her, daG man ut, re, m-. b den vier Elerncnten und die sieben Tone der Oktave cL-:! Plancren gleichsetzte. Nicht nur die Weddas heulen ihre ,:;':he;men Regenweisen, nicht nur die Abstande des chinesischen 'iaircnspieh sind nach dem Abstand der Himmelskorper gesri mrnt, audi noch Dietrich Buxtehude machte sich anheischig, in seincn sieben Klaviersuiten »die Natur und Eigenschafl: der Phneten artig abgebildet zu haben«, Und Shakespeare fahrt leider fort zu Jessica: »Sieh, wie die Himmelsflur ist eingclegt n';, Scheiben lichten Goldes! Auch nicht der kleinste Kreis, den
143
du da siehst, der nidit im Schwunge wie ein Engel singt zum Chor der hellgeaugten Cherubim.« Hier ist die wahre, die innere Nacht verlassen, es regiert die falsche, rein astronomische Theorie der Musik, wie sie schlieBlich Kepler vor allem in Begriff brachte. Hier soli en so gar die verschiedenen Stimmlagen verschiedenen Planeten entsprechen, das Moll soll im Perihel, das Dur im Aphel seine Deckung finden, ja, das gesamte Tonsystem mit allen seinen Harmonien wird als Abglanz des Sonnensystems beschrieben, pythagoraisch als siebenfache Brechung des Sonnenurtons, als lyra Apollinis, und nur innerhalb dieses , Systems legitimiert,
Man hat wenig gcwonnen, wenn dieser Bezug seelenhafter urnbenannt wird, denn auch dann landet der Ton nicht im Inwendigen des Menschen. So wurde beispiclsweise von dem spekulativen Pater Singer ernsthaft versucht, das Moll in seiner Trauer daraus zu deduzieren, daf] es auf der Verminderung des zweiten Tons im Dreiklang beruhe und derart auf Golgatha als Herabsteigen der zweiten Person in der Gottheit hinweise. Solches klingt zwar unbedeutend und skurril, audi tauschr die christliche Sprache tiber Jesus als Sonnenschein tiber' den bodenlosen Astralzauber hinweg, aber es wiederholt sich hier und auch in der modernen Theosophie der Musik nur jene unfruchtbar mystisdie Formalausklaubung par tout, die, Abert gezeigt hat, die gesamte Musikanschauung des Mittelalters unter der Botmafligkeit der Astronomie, der Zahlensyrnbolik, Instrumentensymbolik und Astralmystik halten konnte, Selbst bei Schopenhauer spiegclt noch der schwerfallige BaB die Steine, der Tenor die Pflanzen, der Alt die Tiere, der H""VU"'Fuhrendc Sopran das Menschenreich, und das Orchesrer wird dergestalt zum Querschnitt der Welt; selbst bei diesem allerchristlichsten Philosophen bleibr so die transzendierende Gegenstandsbeziehung der Musik kosmisch abgezielt: denn der Mensch hier ist ja wiederum keine Pointe der Natur, sondern nur die srarkstc, mittaghaflestc, deutlichste Willensobjektivation und als solche gerade dazu berufen, den Schein der Individuation vor der Allnatur zu zerstoren. Ganzlich jedoch liegt fur Schelling das musikalische Gold in der Siebenzahl begraben, und der Keplersche Pythagoreismus triumphiert in dieser Philosophie der Kunst, wo sie sich auf die Musik bezieht, der-
144
maGcn total, daB bei Schelling nicht einrnal mehr die immerhin garenden, indisch zuckenden Autornatismen, wie im Schopenh,1Llcrschen, sondern unmittelbarst Pythagoras, ja Kgypten selbcr zurn Deduktionsort der Musik geraten. Von Schelling starnrnt das eigentlich Begriffliche des Satzes, daB Musik nichts sci als Hirideutung auf Architektur, und diese sei geronnene Musik; danach wird es dem Philosophen Freilich ein Leichtes, die Musik mit dem gequalten Bau- und GroBraumwesen erlosrhcner Astralbeziige zu ruinieren. Er liebt nur die griechische Musik, die er als Melodie schlechthin werret und so auf die geordnete Planetenwelt bezieht: und er verabscheut die neuzeit- 1 ichc Musik, die er als verworrene, unrhythmische Harmonie bezC'lchnet und als solche auf die zentrifugale Kometenwelt reduziert ; wornit also der gesamten »unarchitektonischen«, nach:::ricchischen Musik die Heimat im Planetensystem und darnit die Moglichkeit einer gehaltvollen, logisch gegenstandlichen Disputierbarkeit entzogen wird. So weit in Fremde also, ins Sinn lose und ganzlich Unsachliche Fiihrt der Ton mit seiner naturhaft anhebenden und durchgefiihrten Verfolgung, mag sie sich auch christlich kleiden. Denn es ist, als ob die christliche Sccle seiber, diese musikhafte Seele schlechthin, iiberhaupt noch n icht crwacht ware, als ob die Feuer, die Lampen unserer Sehnsuchr und unserer Arbeit das astralische Kristallgewolbe noch nichr durchgebrannt hatten und immer noch das Tiefste in der Wcl~ nur als das Objekthafteste Fertig kosmischer Art gedacht wcrden konnte. Aber desto kraftiger die Mahnung bei der Chifferdeutung des Tonmoments sich durchaus nur an die mcnschliche Rezeptivitat zu halten, die nichts von aller Astralmystik in der Musik weif], und an das alleinige Wunder der Genialitat, die eben falls keine andere als die ihr homogene Seelcntranszendenz setzt.
Es isr also besser, zu glauben, daf der Ton nur die Herzen zu schmelzen habe, daf er nichts als aufzulockern und zu verwunden habe, urn die Wallfahrt in sich seiber hcrbcizufiihren. Es ist besser, nur an die Wechselbeziehung zwischen der Tonbewegung und der Seelenbewegung zu glauben, in guter Ubereinstimmung mit den Kirchenvatern, vor allcm mit Augustin und seiner Lehre von der die Herzen erleuchtenden Kraft des Tons, von seiner Zauberfahrt und noch geheimen Landung im rein
145
ethisch-mystischen Castel Merveil der Musik. Was hier aber mit den feurigen Armen des sich nach Hause Wi.inschens emporgehoben wird, ist keine zurechtgestellte Liige des wie immer erfreulichen Scheins, der eben als Schein unter der Wahrheit zu stehen hat. Es ist jedoch ebensowenig, womir zwar der Schein zu einern gewissen vertrostenden und irrefiihrenden Widerschein umgewertet wird, die Versprechung zu irgendeiner menschenleeren Hinterwelt, zu irgendeinem sinnlichen Reflex der seit alters als menschenfrei gedachten, allgemeinen Idee, sei sie als Nus, als Pneuma oder auch als Wille zum Leben, als konternplativ begonnenes Nirwana fixiert. Denn auch Schopenhauer ist noch weir davon entfernt, das wahrhafl: Apeironhafl:e der Musik zu verstchen, sofern er diese nur passiv, kosmisch und nicht im Individuellen, Heroischen, Christlichen verankert, sofern er mit anderen Worten der Musik zwar die Krafl: gibt, der Erscheinung das Ding an sich hinzuzusetzen, jedoch dieses Ding an sich lediglich als ein Metaphysisches unbestimrnter, individuationsloser, prozelifremder, ja bereits empirisch allerrealster Art definiert. Die Selbstbegegnung, Wirbegegnung (und es ist in jedem wahrhafl: Schaffenden eine tiefe Leidenschafl:, erkenntnismaiiig zu beziehen), wie sie als Grundbegriff der Wertphilosophie letzthin der Apokalypse, der letzthinnigen Enthiillung des Wirproblems, als dem Grundbegriff des gesamten Systems der Philosophic entspricht, darf das Wahre weder als einfach induktive Tatsachenlogik noch auch als griechisch definitive Umfangslogik eines Allgemeinsten und darum Realsten bestehen lassen. Sondern es gibt, wodurch eben der verantwortliche Ki.instler dem Philosoph en naher steht als der subjektlose Empiriker, noch eine andere Wahrheit als diejenige dessen, was gerade existiert; eine, die nur auf uns geht, auf den Urnkreis der von uns gefarbt erlebten, beschleunigend aufgefaBten und religios vollendeten Welt, auf eine durchaus »subjektivc« und doch hochst substantielle Welt - jenseits des bloB ernpirischkomparativen Status des gegenwartigen Zustands und seiner einfach erreichten Seinslogik -, gerichtet nicht auf Dingklarung und nichr auf Menschenklarung, sondern auf eine erste Adaquation der Sehnsucht an sich sclbst, auf das Innere und unbekannte sich Vernehmen hinter der Welt. Und dazu unterhalt der Mensch in der Musik allerdings starke korrespondierende
146
Gcgcnstandsbeziehungen, zum grofsen Teil noch kiinstlerischspezifischer und bei entsprechender Erweiterung des Begriffs auch immanenter Art, vor und hinter den Regeln der transzcndcntalen Synthesis ki.instlerisch-phantastischer Apperzeption und ihres Phanomenale, ihres material-phanomenalen Erfiillungsmoments. Es ist die sprunghaft indirekte Beziehung auf den unsichtbaren Menschen, auf die im Klangbild vernommene, sieh annahernde Gestalt des Hauptes, des Ingesindes, des eschatologisdien Scelengrundes, der Wiederherstellung des Grofsen Mcnschen, der gebeimen, absoluten Menschheitsfigur aus dem Labyrinth der Welt.
Uber das Ding an sich in der Musik
Nur wcnige aber kommen schon dahin, sich rein zu horen,
Sic zcraten unter sich, sie tauchen in Schlaf, traurnen falsch und bclicbig am Ton entlang, darnmernd und vage sowohl Versunk encs wie nicht Gekommenes in sich auffarbend.
Die Bessercn werden zwar wach, bringen nicht sich mit, wie sic gcrade sind, aber sie werden zugleich auch trocken. Sie halten sich als Kenner am Geriist fest und glauben, an diesem, an den durchschauten Mitteln, begriffenen Forrnen, musikhafl: gegcnsr indlich zu sein. So haben auch diese Rationalen nicht die rcchtc Spur, und fast mochte man nun wieder lieber die wolliistiC;CT1 Schlafer ins Reine bringen, als welche sich doch wenigstem, wenn auch noch so dumpf und irrcnd, seelisch in einem Sc<'!ischen bewegen. Denn so sehr auch lediglich die Form pr:lgt, cntdeckt, dem Damrnernden hervorhilfl:, so wenig begreift sid1 doch durch sie allein, fiihrt nicht ausdrucksvollste Person dur ch sic empor, das musikalische Wunder. Seine Frage steckt irn Ausdruck dessen, was gesungen werden kann.
Leider fiel gerade dem Schlafenden, der unter sich schwelgt, vic-lfach Cehorres zu. Denn vor allem doch auch entdeckt sich dcr falsch assoziative Zuhorer in Wagners eigenti.imlich verschwimmendem Wesen sehr leicht wieder. Nicht etwa, wei I hier l1l~hr noch als bei Beethoven kleine, altgewohnte, vordem respektvoll miterfalite Formen zerbrochen worden sind. Denn daflir kam expressiv noch tiefer begri.indete Form, die zeigt,
147
wie aulierordentlich viel musikhafter Wagner bestimrnt war, als er seiber, der Obertrager der musikalischen an die drarnatische Folgeriditigkeit, wahr haben wollte, Es genligt hier, iiberfliissiger Weise, auf die Feinheiten, auf das sich bliihend verspinnende Melos, auf das auEerordentliche Handwerk in den Meistersingern, auf die harmonischen Neuerungen, Rezeptionen und riesigen Spannungen, vor allem aber auf den Reichtum an Synkope und Polyrhythmik im Tristan, und noch mehr auf Wagners hochst spezifischen, bei Bruckner exaltierten Kontrapunkt hinzuweisen; wie denn Wagners Genius vor allem auch rein tcchnisch in gar keiner Weise aus der musikalischen Entwicklung herauszudenken ist. Nannte man, obzwar mit zweifelhafter Berechtigung, Beethovens Symphonien verk appte Opern, so lassen sich vie! gewisser umgekehrt Wagners Musikdramen auf weite Strecken hin vollig musikhaft - ohne Kenntnis des Textes und seinen angeblich allein begrlindenden Zusammenhang - als rechtrnaisige Steigerungen und Durchfiihrungen, als Ausspinnungen rein musikalischer Logik erfassen und genielien. Das muf einer falschen und wiederum un~aEig ansteigenden Kritik gegenuber gesagt werden; rrotzdem jedoch und Freilich leistete Wagner den schmelzenden Schlafern vielfach Vorschub, sofern er den Zuhorer trotz und selbst noch hinter aller Technik falsch bei sich ankommen lieE. Er gab den Traurnenden, die blof] unter sich schwelgen, allzu sornnambule Gelegenheit, der Brunst, dem Dunstkreis und der Traumschicht eines bloE animalischen Gedachtnisses zu begegnen. Daran eben wird klar wie wenig gute Arbeit hier an sich schon bestirnmt oder rettet. Denn das eigentlimlich schwiile, widergeistige Wesen Wagners liegt jenseits von Melos, Harmonie und Rhythrnik und zeigt sich als durch seine eigentiimliche musikalische Gegenstandslebre seiber verursacht. Diese erst erzwang die Herabdrangung des Tons, seine gegenstandliche Beschrankung auf das Dumpfe, Ertrinkende, Versinkende, unrerbewullt Unbewuiite, Animalische; und menschliches Gewissen, das dagegen schlug, lieE nun nichr etwa den Ton, seine ihm eingeboren seelenhafte Sprache zu Ende reden, sondern hie! t ihn unten, gestaut, in ada quat, und iiberkompensierte das Trlibe ledigli~ durch die Verstandigkeit des Worts. Derart wurden zwar die »Motive« roman tisch ins Orchester verlegt, aber das eigentlich
148
l.oscnde, Expressive dariiber wurde nicht der Musik, sondern, in auEerlich Gluckschem Klassizismus, dem Sichtbaren, dem Wort, dem Drama als der letzthinnigen Tonika der Musik anheimgegeben; - freilich eben doch nur wiederum das Expressive »verworrener Vorsrellung«, der »petites perceptions- traumender Monaden, der »confusa conceptio« leidender, unfreier, von inadaquaren Ideen geleiteter Affekte. Dergestalt also drangte sich die gestaute, die nicht zum Ausreden gebrachte, die urn die Srunde ihrer Selbstsprache, urn ihre menschenhafl absolute Pocsie a se gcrade »poetisch« betrogene Musik bei Wagner imrner weiter in den Gcbieten der Unfreiheit aus. Gewif nicht, ohne haufig uberzuschlagen, ohne kraflig ins Seelische aufzubrausen, nicht ohne leuchtende Ahndung der anderen, iiberbewuliten Seite; aber doch irn Ganzen tierisch und heidnisch gerichtet, im Autornatismus des Wahns landend, in den Angstuud \Vonneschreien fremd gejagter Kreatur, in den Entzuckunhen gestillter Wollust oder, allerlerzr, trotz Gral, im menschenlccren Schattenland des toten Pan.
So treiben wir hier dahin, und fast nur die Gier will tonen. Sclbst die Entsagung, die sich auftut, arbeitet mit weltlichem Glanz. Ihr Himmel liegt selten allzu hoch tiber dem Strande, \'0 Tannhauser in den Armen gliihender Liebe traumt.
"IJ:'ic nun bekannt, hat sich Wagner erst spat, als die Sackpfeife ':ingsr schon zu locken verstand, mit Schopenhauer befailr. So viillig abcr auch der Musiker des Untergrunds aus sich gewach'en ist, so wirkt diese seine Kunst dennoch wie eine ungeheure Probe aufs Exempel der Schopenhauerschen Musikphilosophie. In der Tat ist fast die gesamte Wagnersche Gegenstandsbeziehung bei Schopenhauer vorgebildet; doch dieser lehrt nidus unci sagt nichts aus iiber die Gegenstandsbeziehung Beethovens oder Bachs oder gar der ungeahnt expressiven Zukunft angebngtcr Musik iiberhaupt; - auch in der Welt als Vorstellung h!eibt schlechthin die Welt als Wille Objekt der Musik.
Denn wir bleiben hier erst recht un ten, und die Weise, nicht inchr zu sein, sondern zu sehen, trifft doch nichts als Gier an une! kaurn sogar, was sie stillt, Leicht gehen zwar die Augen tiber, aber das Innere, das sonach bei Schopenhauer erscheint, tont nur triebhaft, getrieben wieder, voll Angste oder kurzem
Genuli, mehr ist hier nicht zu find en. Die aufs Licht und den Satz vom zureichenden Grund gestellten Kiinste spiegeln hier von auBen das gleiche Wesen, nur im Schatten seiner Rclationen; sie haben bestenfalls die Formen der Willensobjektivationen, dieser sonderbaren Zwischengebilde zwischen Vielheit und Einheit, zwischen Tauschung und Realitat, zum Vorwurf. Jededi eben, wie sich irn Schrci Sdiopenhauers Wille ganz unmit- , tel bar kundgibt, und wie die reflexive Anschauungsform der Zeit nur noch gleich einem flieBenden Schlcier den Kern der Natur, Menschen im Herzen wohnend, umhilllt: so spricht nach Schopenhauer Musik, zum Unterschied von den anderen Kiinsten, nicht mehr von den Erscheinungen und ihrem endlosen Bezug, auch nicht mehr von ihren Objektivationen oder platonischen Ideen, die fast schon zu geistig scheinen, sondern vom alleinen Wesen selber, von lauter Wohl und Wehe, von demI Weltwillen und sonst nichts, als dem Allerernstesten, Allerrealsten i.iberhaupt.
Man begehrt hier also nicht hoher, geniefst und ist am Ziel, der Ton spricht das Leben vollstandig aus. Obzwar er nicht eigentlich malen darf und Erscheinendes nachahmen, so ragen in die! Musik Freilich die Abstufungen des Willens herein. Dergestalt, daB sich hier die ganze Welt von ihren schwersten Lagen bis zur Menschcnstirnrne dari.iber, bis zur fiihrenden Melodie widerspiegelt, als welche das vielgestaltig rastlose Wesen des Willens am reinsten und zuglcich bereirs besonnensten ausdriickt. Nur legt Schopenhauer auf die einzelne Entsprechung zwischen Musik und weltlicher Ideenstaffelung lerzrhin keinen entscheiden den Nachdruck; wichtig bleibt vielmehr stcts das Eine: alles, was geschieht, verhalt sich zum Ton nur wie ein beliebiges Beispiel, die Musik hat zu jeglicher Bekleidung mit Fleisch und Bein, zu aller Oper- und Weltszene stets nur ein mittelbares Verhaltnis, sie dri.ickt das Wesentliche des Willens gleichsam in abstracto, ohne alles Beiwerk, und ohne aile Motive aus, sie ist die abgezogene Quintessenz der Gefiihle, der Leidenschaften, kurz, die Musik ist die Melodie, zu der die Welt schlieBlich insgesamt der Text ist, so daB man also die Welt ebensowohl verkorperte Musik wie verkorpcrten Willen nennen konnte. Ja, Schopenhauer hebt letzrhin die Musik sogar so vollig von allern und jedem Parallelismus zu den Willensobjektivationen ab,
qo
daG er behauptet : die iibrigen Kunste geben den Willen nur minelbar, sdiattenhafl, von auBen, mittelst der Ideen; und da unscre Welt nichts anderes ist als die Erscheinung der Ideen in dcr Vielheit, so isr die Musik, da sie die Ideen iibergeht, auch yon der erscheinenden Welt ganz unabhangig, ignoriert sie sc!hlcehthin, konnte gewisserrnafien, auch wenn die Welt gar nichr da ware, dennoch bestehen; kurz, die Musik setzt zur Ersrhcinung nicht mehr die Anschauung ihrer platonischen Idee, wic die i.ibrigen Kiinste, auch nicht mehr die vom Einen zum Anderen endlos weitergeschickte Erkenntnis wie die Wissenschafl, sondern sie setzt iiberall und allsogleich Dasselbe, das Allbetreffende, das zeitlos, raumlos Identische, eben den Willen sclbsr als das Ding an sich; - worauf eben das unaussprechlich I nnige der Musik beruhe, ihre Kraft zur somnambulisehen Offenbarung des innersten Wesens der Weit. Obzwar also dem Ton die in ihn hereinragende Sehichtung der Welt letzrhin nicht wesentlieh ist, so ist er doch immerhin ins innerste Wesen der W,lt und nur der Welt unverrUckbar eingebaut: derma Sen krcislaufhaft also ist die Beruhigung, die uns Musik hier ver- 1ciht. Die hochste asthetische Erhebung iiber die Welt stiirzt den Mcnschcn erst recht wieder ins Zentrum dieser Welt hinein, worin Musik ihren ewigen untermenschliehen Bann haben soil. De- Schacht der Seele, der Umkehr, der Ahndung ist hier vollig vcrschlossen, und man sieht nieht, was ihn aufsprengen konnte. Nichts bleibt hier gerade dunkler als »das unausspreehlich Inngc der Musik«, nichts bleibt unbegreiflicher als "die tiefe \\'"i,hcit in ihr als einer Sprache, die die Vernunft nicht ver"chr«. und die doch Schopenhauer vollig entratselt haben will. \ c'rc:ebcns versichert Schopenhauer - gerade den tiefsten Konklmionen seiner Philosophie nach vergebens -, daf aile Musik :len Ziel sei, nadidern doch ihr Objckt stetig nur der Wille b1ciht. V crgebens auch bleibt der Satz, daf die Musik gewisserDla~cn bestehen konnte, selbst wenn die Welt gar nicht ware; dCl1n sie konnte doch nur insofern bestehen, als die Musik hier die Welt nochmals, in erhohter Bedeutung, hervortreten laBt, als lie mit anderen Worten eine genau so unmittelbare Objektiqtion des gesamten Willens darstellt wie die Welt seiber; so d]f\ folglich die Musik - weir davon entfernt, ein Panacee unserer Leiden zu sein - den Weltwillen, dessen Schreie sie klin-
151
gen lafh, eher bestarkt und bejaht als wendet. Nirgcnds fiihrt die Philosophie Schopenhauers an sich seiber in den Schacht der Seele, in die ganzliche Meeresstille des Gcmiits, in das Nichts, in dem er das All zu finden lehrt, und das er demungeachtct vollig transzendent sein laBt, obzwar die Mystik »allerchristlicher Philosophic- hier doch erst zu beginnen harte. Gcrade das Inwendige sieht sich trotz aller letzthinnigen Willensverneinung vollkommen verleugnet: »Sobald wir in uns gehen und uns, nachdem wir das Erkennen nach innen richten, cinmal vollig besinnen wollen, so verlieren wir uns in eine bodenlose Leere, . finden uns gleich der glasernen Halbkugel, aus deren Leere eine Stimme spricht, deren Ursache aber nicht darin anzutreffen ist, und indem wir so uns selbst ergreifen wollen, erhaschen wir, mit Schaudern, nichts als ein bestandloses Gespenst.« Kurz, der Geist ist bei Schopenhauer zwar die Lyra, aber das Plektron sind allemal die Objekte, und diese, die Welt und ihre Substanz, schenk en schliefslich auch die einzigen Inhalte, die der Lyra zu ton en aufgegeben sind. I tern: auch in der Welt.,1s Vorstellung bleibt scblecbthin nur die Welt als Wille und niemals die Sezcssion der Vorstellung aus der Welt in sich selber Objekt der Musik.
Die Menschen folglich, so sehr sie Teile des Wahns sind, vermogen hier doch nicht einrnal so selbstandig wie solche zu handeln. Sondern sie sind blolle Schauplatze, geprellre, ironisierte Pup pen in der Faust des alleinen Gotz en und in scincm Schauspiel. Sie glauben ihr Eigenstes zu suchen und betreiben doch nur die Geschafl:e der Gattung, dergestalt, daf iiberhaupt kein originaler »Antrieb« in ihnen wirkr, sondern daB hier der gleiche Fatalismus, Okkasionalismus, die gleiche Verschiebung der »Realursache- ins Urwesen allein statthndet wie in den iibrigen reaktionaren System en der Romantik; rnogen auch die Begriffe »Antrieb- oder »Realursache« fiir einen, der den Satz vorn Grunde so sehr verachtet, nicht entsprechen. Die Individuen und ihr eigener, ihr nicht nur triebhafl:er Wille sind nichtS vor der der Einen, der allein realen Weltwillens- oder auch Weltgeistwoge, die will. Foiglich hat hier auch Wagner seine Philosophie gefunden, vie! Wagnersche Musik als Drang, Wahn, Gliihwurmgleichnis, Wogen, Dampfgewolk und Hochschlaf des Unbewufstseins ist Exponent des gleichcn rasenden
152
und ewig statischen Autornatismus, des gleichen subjektfernen Naturmarchens. Gcwil] durchbricht Schopenhauer seine ungemaGe Immananz zuweilen, und die schwere Welt rollt zur Scite; aber ront ihm auch vie!es in diesem Leben bercits wie K hnge aus einem Orchester, das sich vorbereitet, eine schone, groGe Symphonic zu erheben, so wendet ihm die Musik doch wahrhafl: kein Elcnd, so blcibt dern Aspekt der Wagnerschen Musik wie der Schopenhauerschen Philosophie die Welt, auch als Objekt der Musik, jederzeit doch nur der verschlingende, zcugcnde Todes- und Geburtenstrom, als der sich Krischna dem Ardjuna in seiner wahren Gottesgestalt zeigte. Eine, wie zu sar;en war, sonderbar subjektlose Ticrlyrik tut sich auf, vor allem im Nibelungenring; diese Menschen sind nicht dramatis personae, in den Raum der Begegnung aneinander und der eigenen Schicksalstiefe hineinschreitend, sondern Bli.iten an einem Baum, ja sogar nur tanzende Schiffe, die widerstandslos das Lcid, den Kampf, die Liebe und Erlosungssehnsucht ihres untermenschlichen Meeres mitmachen; i.iber die also in jedem entscheiden den Augenblick die Weltwoge des Schopenhauerschen Willens hinweggeht. Jener Ding-an-sich-Gier also und ihrer Diktat ur , die nicht nur dern moralischen Willen der Beethovenmusik frcmd ist, sondern die einen spezifisch Wagnerschen Anfang von brcnncnd-spirituellem Espressivo abdrangt, einhiillt.
Doell es steht bevor, sich selbst bald rein und tief entgegen zu horcn. Es gilt, das schweifende Horen endlich auf sich seiber III richten, die Seele zu fassen. Dazu hilfl: gewiB auch eine besscre technische Schulung des Laien, damit er wenigstens cincn ersten Halt gegen die fliichtigen Tiefen gewinne.
lndcs letzrhin eben empfangt sich doch immer nur der Harer, erst arkt, gedcutet, aus den formenden Zuri.istungen zuruck. Der ergriffene, zutiefst unkennerische Zuhorer muB genau bewahrt bleibcn, begriffen werden, urn als der, urn dessenrwillen alles geschieht, hinter dem Tongefi.ige und seinen Regeln, also an der Stelle, die ihn meint und erwartet, wiederum hervorzutretcn. Auch der Kiinstler, der ja die nidits bedeurenden Mittel (wie Tonalitat) fortschreitend preisgibt und nur noch transzendicrende Formen (wie Rhythrnik und Kontrapunkt) weiter groB zu seinem Dienst ausfiihrt, - auch der grolse Kiinstler ist
153
letzthin nur sein eigener Zuhorer. Er leistet als Erster, srellv ertretend fiir aile, die Bedeutungsintention aufs Inwendige, . urn so erst, erkennend, gleichwie er im gemeinsamen Raum erkannt wird, dem sich lichtenden Estaunen, dem sich ann ahemden utopischen Seelengrund entgegen zu horen. Dieses eben bedeuter, den Zuhorer statt des Kenners, start der blofsen Formanalyse, gegenstandlich ins Reine zu bringen und das lnnere alles sich entgegen H orenden, den gestalteten Klang als blo/1e Aura des sich wieder antreffenden Zuhorers ans Ende der Musik zu setzen. Nicht vor dem Werk, durchaus nicht, sondern erst dahinter, dariiber, auch noch hinter seinem falschen, heidnischen Umkreis dehnt sich das Geisterreich der Musik; dringlich fern aller bloiscn »Psychologie«, grundsatzlich erhaben uber Schopenhauers Heidentum als Objekt der Musik, reinessich-selbst-in-Existenz Verstehen mit dem Wirproblem und seiner Metaphysik als Gegenstand und Substanz. Ein neues Ich, das genau beriihrte J ch der Ahnung und Versammlung, ist derart auch hinter allern Begriff musikalischer Form neu einzusetzen, als Funktion metaphysischer l\sthetik neu zu installieren, soli die Erschiitterung gerettet und befestigt werden, soIl das Wozu und spirituale Ende der Musik - einer einzigen tonenden Ketzergeschichte - adaquat zum Begriff kommen. Denn sie bliihte auf, die Musik als das Sehen, Hellsehen, die sichrbare Welt, auch die Spuren Gottes in der sichtbaren welt zerfielen; sie isr mit tieferem Grund, als bisher noch erschien, die spa teste Kunst, die Erbin der Sichtbarkeit, ist der formcxzentrischen Geschichtsphilosophie, Ethik und Metaphysik der Innerlichkeit zugehorig. Die Konklusio aus dieser abendlichen Spate und Oberholung jeder Gestalt oder Species ist endlich zu ziehen: nun tritt das Rufen und Horen seiber hervor, Gewalt der Zeit und riescnhafte Strategie, Schreien, Klopfen, Pochen, namenlos heraufdamrncrndes Hellhoren und Geburt des Kerns, des klanghaften, noch nicht seienden, unernannten Kerns aller Dinge, ringende Geburt auf dem Herd der Musik; - und sofern sich hier das Hellsehen aller Zeiten mit Ernst vcrwandelt hat, geht der seelenlose Kopf als Kiinstler wie als Denker zugrunde, erlangen sich Existenz wie Begriff der Musik nur noch gemeinsam mit der neuen Gegenstandslehre, mit der Metaphysik von Ahnung und Utopie.
154
Audl dieser zwar, ob sie gleich uns so nahe wie moglidi steht, kommen wir nur traumend nahe. Aber es ist nicht mehr der Traum, der sich an Vergangenes erinnert oder sich in mancherlei untere Brunst einwiihlt, Sondern nur jenes Sehnen, das Uncrfiilltes mit sich fiihrt, wie es irdisch iiberhaupt nicht zu erfii [len ist, der wache Wunsch nach dem uns einzig Gcmalien c'!l;ht auf im wohlbezogenen Tonen, So tief ist uns dieses vertraut, macht gut und hell, fiihrt ins Herz, und das einzig Gemeinte sieht sich darin geheimnisvoll selbst entgcgen: »wo ist Paul, der Dieb?« fragt Claudius, »in den Wald gegangen; ich n.ich, blickte wild durch Busch und Baum und wollt ihn schlagm, wo ich ihn triife, und das Blut kochte mir in den Adern - ~i;t fingen in der Ferne des gnadigen Herrn seine Jager an zu l-l ascn. So hart's mir niemals noch gedaucht ; ich horte, stand srill und sah urn mich. Ich war grad an dem Schmerlenbach, und Nerd' und Kiih und Schafe standen am Ufer und tr anken aile a us dem Bach, und die Jager bliesen. - -Harte Taler hin, harte Taler her! will Paul nicht schlagen-, und ich vergab ihm in mcinem Herzen am Schmerlenbach, wo ich stand und ging wicdcr nach Hause.« Aber hoher noch ins Gefiihl des »Besserwcr dcns«, Selberwerdens geht E. Th. A. Hoffmann ein und der Frerndc, »der ihm von den vielen fern en, unbekannten Landcrn crziihlte, dessen Sprache von seiber in ein wunderbares Tonen \ crhalltc«, und die vertrauteste Ferne bricht auf, die GewiBI,e;t an ihr, daB uns irgendwo und zu irgendeiner Zeit »ein huher, den Kreis alles irdischen Genusscs iiberschreitender Wunsch erfiillt werde, den der Geist wie ein streng gehaltenes, ~urchtsames Kind gar nicht auszusprechen wage«. Und vollig ~',,'lr in diese echteste Richtung der Musik w eist uns Jean Pauls Frage: "Warum vergiBt man dariiber, daB die Musik freudige unci traurige Empfindungen verdoppelt, ja sogar seiber erzeugt, daG sie allmachtiger und gewaltsarncr als jede Kunst uns zwischen Freude und Schmerz ohne Ubergange in Augenblicken hin und her stiirzt - ich sage, warum vergiBt man eine hohere Figentiimlichkeit von ihr: ihre Kraft des Heimwehs, nicht ein Hcimwch nach einem alten verlassenen Land, sondern nach cinern unbetretenen, nicht nach einer Vergangenheit, sondern nach einer Zukunft?« So vollig ist Musik das Pfand des Driiben, Trostgesang, Todeszauber, Sehnsucht und unser eigenes
155
Anlangen zugleich, Nachtblume des Glaubens, die starkt im letzten J.?unkel, und machtigsr transzendente Gewiilheir zwischen Himmel und Erde: nicht die Glut Leander, also, die Schopenhauer allein intendierte, sondern durchaus, viel sicherer nocb, bre~nt die Lampe Heros im l nneren grofter Musik, als ~em an sich selbst aufleuchtenden Traumhimmel der menschl~che? S:ele .. Wagner blatterte zuriick, Schopenhauer stiirzte sich III erne irnmer hoffnungslosere Welt, suchte, Kants Warnung iiberschlagend, den Narnen des Dings an sich im vorhandenen Sein, in der Natur; und wenn auch der hier intendierte W eltgott h?chst e~rlich zurn Teufel geriet, so wies Schopenhauer dennoch die Musik auf das blofse Horen dieses Seins dieses We!ts~atus, und nichr auf die Ahndung der Verborgenheir, nicht auf die Entdeckung eines Schatzes, unseres Erbes hinter der Welt, hinter der nachsten Wegbiegung der Welt. Er wies nicht a,uf Beetho.ven: auf sein rhythmisch riesenhaft gestalteres Empor, luzlfensch-mystisches Reich; nicht auf Bach den Gesang der geistlichen Seele, in sich selbst einscheinend, auf die g.ro~e Orgelfuge, getilrrnt, mit Treppen und Stockwerken, eine emzrge selbstleuchtende, riesenhafte Kristallglorie, nicht auf die Versprechungen der messianischen Heimat hinter allen Entde~ungszugen, hinter allen luziferischen Stiirmen auf den Himmel. Uns aber ist nichts anderes mehr als dieses zu wollen nur noch zum Unsagbaren, wenn die Miene und das Wort er~ starrt, ist d~r Ton besrellr. Spuk und Maskenspiele, Spicle des wahren Gesichr, k~mmen herauf, der Lachspiegel Filr die heite~.e,. der Zaubersplegel fur die ernste Oper ; »Musik, schwerm~tlge Nahrung fur verliebtes Volk «, und jene Musik, die erk!lllgen ~u~, sobald Obersinnliches in die Handlung eintritt ~IS da~ sich -. gema~ Busonis echtem Durchblick _ das Unrnogliche der Musik dem Unrnoglidien, dem Visionaren der Handlung verbinde und derart beide moglich werden. Aber zuletzt, sobald auf der Erde, in der irdischen Handlunz alles schweigt ganz lich des Tcxtes, selbst noch der Shakespea~eschen Traum~ welt, Tanz-, Masken-, Rausdi-, Zauberwelt entratend [iigt die Musik Zuge des anderen Worts zusammen, das Wort ~us ande:-em Kehlkopf und Logos, den Schliissc] zum innersten Traum irn Haupt der Objekte, ihren eigenen signifikant gewordenen Ausdruck, den vielfach cinen letzten Ausdruck des Uberhaupt.
156
Jctzt noch heifses Stammeln, wird die Musik, in zunehmend expressiver Bestimmtheit, dereinst ihrer Sprache teilhaftig: sie gcht auf das Wort, das uns einzig lost, das in jedern gelebten Augenblick als omnia ubique verschlossen mitzittert : Musik und Philosophie in ihrem Letzten intendieren rein auf die Artikulierung dieses Grundgeheimnisscs, dieser nachsten wie letzten Fr.ige in allem. Denn das Ding an sicb, noch allein in geistlicher Schnsucht »ersdieinend- und so auch der Musik vorgeordnet, ist, was in der nachsten Ferne, im actualiter Blauen der Objekte rrcibt und traumt ; es ist dleses, was noch nicbt ist, das Verl o icne, Geahnte, unsere im Dunkel, in der Latenz jedes gelebten Augenblicks ucrborgene Selbstbegegnung, Wirbegegnung, nn-cic durch Giite, Musik, Metaphysik sich zuruiende, jedoch '"lise}; nicht realisierbare Utopie. ]e weiter, unabgelenkter der Ton dcrart in sich eingeht, des to vernehmlicher auch tritr der Ursturnme aus ihm hervor, sich das alteste Mardien erziihlend: aber er ist, was er sich sagt. Beginnt so endlich der gelebre Augcnblick, in sich seIber angehalten, aufgebrochen, zu gehcirnstcr Stube dahingestellr, zu ertonen: dann haben sich die Zeiten gewendet, dann ist der Musik, der wundertarigen, transp.ircnten, iibers Grab, tiber den Ausgang dieser Welt mit hin,Jusgehenden Kunst, die erste Fiigung des Ebenbilds, die ganz .rudcre Nennung eines Gottesnamens gelungen, des so verlorencn wie ungefundenen.
DAS GEHEIMNIS
\Va suchen, wohin das Hellsehen versdiwunden sei. Ein FluB \crsiegt im Boden. Plotz lich tauchr weit davon entfernt ein anderer FluB auf, der nie vorher an dieser Stelle zu sehen war, dcr mindestens in diesem trockenen Gebier keine Quelle hat. K:lnn man so bestirnrnt, wie man diese beiden Flusse in einen 7usammenlegen darf, auch das Hellsehen und die Musik in Zusdmmenhang bringen? Sie waren nie gleichzeitig zusammen zu erblicken, aber als das Eine ging, wuchs das Andere langsam ':rug und wie es sdieint, genau aus den gleichen Kraflen groll, Fs isr Freilich unbekannt, ob auch zum gleichen Kraflegebraudi und syrnpathetischen Gebilde. Wenn wir also fragen, was das j ruher gewesen sci, das jetzt Musik ist, urn eben dadurch ge-
157
nauer zu erkennen, was Musik sei, so reicht selbst die erkannte Verwandtschaft an sich noch nicht zur naheren Bestimmung aus.
Denn wir werden allmahlich blind auch fi.ir das Draufien. Fi.ir dasjenige, das i.iber uns liegt, sind wir schon lange blind geworden, auch das christlich aufhellende Licht ist vorbei. Die sinnlichen Augen haben sich zwar sparer geoffnet als die iibersinnlichen und kamen, als diese sich schlossen; oder vielmehr, durch den sinnlichen Augenaufschlag, den ernporerischen, sich selbst eindrangenden, ist die iibersinnliche Welt steigend zuri.ickgetreten und allrnahlich ganz vergangen. Friiher, in den Tagen, aus denen uns die Marchen erhaltcn sind, waren die aufieren Dinge verschleiert oder ganz unsichtbar, aber dahinter bewegten sich aufs Hellste ihre Gruppenseelen, die Quellgeister, Baumgeister, Schutzengel, Sirius und der Jager Orion, die bunten Wolken des nachtlichen Himmels und die ganze Nahe der anderen Welt. Jedoch man er innert sich jenes rornischen Admirals, der das vorher Unausdenkbare wagte, die heiligen Hiihner, die nicht fressen wollten und so der Seeschlacht eine schlirnme Prognose stell ten, ins \X'asser werfen zu lassen: wenn sie nicht fressen wollen, so mogen sie saufen " und das noeh zur Zeit der sibyllinischen BUcher. So bildeten sich bald die sinnlichen Organe scharfer aus, die sichtbare Welt wurde dieht, crdriickend, abschliefsend real, und die unsichtbar gewordene, iibersinnliche, sank zum Glauben, zum blolicn Begriff, zur platonisch-plotinisehen Himmelsleiter oder Ideenpyramide. Selbst die Orake! wurden zwcideutig, ja unverstandlidi, und so vcrstarkte sich die Dicsseitigkeit, die Ausbildung der zunachst nur mehr mit Militar, Jurisprudenz, Kalkulierbarkeit und realem Kausalnexus rechnenden Gesinnung immer rationaler, bis endlich in den Tagen des Kaisers Augustus jede sinnliche oder aueh gedank liche Beruhrung mit der Transzendenz verschwunden war. Da wurde Jesus geboren, die Seelenwanderung Gottes seiber, und die Menschen durften sich vor der Gnade dieses auch in die Finsternissc scheinenden Lichrs, das heifit also, dieser wieder offcntlichen, auch den sinnlichsten Organen erkennbaren Fleischwerdung, Erdenfahrt, Publiz itat des Logosmysteriums aufs neue des Oberirdischen versichert halten. Wir sehen abet seit vierhundert J ahren, seit Luther und der Renaissance, trotZ
158
der wieder hervortretenden Diesseitigkeir, selbst trotz der erneuerten Gewalt, mit dem sich ein Freies, Mannliches, Wirkendes, Luziferisches, Vernunfthaftes bewegt und in W cit und Oberwelt hineinstiirzt, ein Doppeltes am Werk. Denn es beginnt einmal auch rings urn uns allmahlich finsterer zu werden, n.ichdcrn es sich iiber uns schon lange zugezogen hat. Die Nacht riickt weiter vor und nicht nur einseitig wie in der rornischen Zeit, sondern auch die sinn lichen Vordergrunde beginnen zu ell t weichen, so sicher wie das darin geschehene obere christliche LIcht schon lange entwichen isr. Jedoch zum andereri auch: hell, allcin noch hell brennt auf der inneren Seite das ichhafte Licht, und breit konnten darin die unbetriiglichen Krafle erwachen. Die Seele weint in uns und sehnt sich liinuber, setzt Gott und den Traum; was aber das Dunkel der Nadir vor sich herjagt, wie Orpheus die Schatten, ist rein aus der Seele geboren und h.u nichts als diese innerste Eurydike zum Zie!. Die Subjekte SI nd das Einzige, das in allem aufieren und oberen Dunkel nicht .iusgeloscht werden kann, und daf der Heiland lebr und wieder komrncn will, dies ist nach wie vor unangreifbar vcrbiirgt; aber er und Gott seIber haben wie alles Objektive die eigene K r.ifl. zu kommen, und scheinend zu wirken, eingebiiflt ; die Zei t der vollig reinen, von Jesus in uns zuerst eingesenkten Subjcktmagie, vollster luziferisch-parakletischer Entfaltung ist g(·kornmen. Derart gibt es hier nur eine einzige Rettung, und d.1S ist die sich ernporende, sich i.iber allem Frernden suchende Vcrbindung zwischen dem moralischen Ich, das allein noch in <in J'\ acht des Aufieren und Oberen Licht brennen kann, - die Vcrbindung zwischen diesem lch und dem schweigenden, uns verlassenden, vor seiner Verwandlung zum Heiligen Geist ziigernden Gott, als die Rufe, Gebete und die tiefe ErnenllullL;skraft des heroisch-rnystischen »Atheismus. seiber.
D:lmit also, indem wir tri.ibe und schwanger sind und uns denill,dl sonderbar schon zuriickstrahlen, ist ein anderes Hellsehen w:cdcrgekehrt. Es war schon Fruher da und wirkt jetzr gleichsam ricochctticrcnd, aber alles daran ist anders geworden, einlarner, untcrstiitzungsloscr, produktiver, Fremdes nicht mehr widerspiegelnd, sondern in ein Leercs vor uns hineinstrahlend, ~chon in seiner Funktion. Der treffende Blick hat sich gewandel t; die Perser, Chaldaer und Agypter, die Griechen und Scho-
I59
lastiker, allesamt obne jede nennenstoerte Tonkunst, diese Meister des Fertigcn und Geschlossenen, der festen Figuren Definitioncn, der Abspiegelungen statt der Erzeugungen, haben ihren Lohn, den Lohn des bildhaA:en Hellsehens und des garan- . ticrtcn Himmels voll lauter Sichtbarkeiten und Objektiv itaten dahin; aber den neuen Menschen ist statt des alten Bilderreichs, start des alten heimatlosen Oberschwangs der Trostgesang der Musik geschenkt worden. Darum wurden die gro- 6en Musiker in dem Ma6e bcdeutend, als sich die Bodenstandigkeit, auch die andere feste, geistige Bindung des Mythos lockerte, ja, selbst Volkslied und Kirchenlied sind nicht die letzten Nahrquellen, tragen, nun wo sie verschwunden sind, sichtbar nicht die letzte Substanz der Musik; und diese ist im sclben Ma6 gewachsen und konstitutiv geworden, als auch die Philosophie gezwungen, begnadet wurde, auf Tathandlung, auf Substanz als Prozeli, auf Wahrheit als Weltaufhebung auszugehen. Es ist derart ein anderes Licht in diesem Hellsehen des Ohrs, der Musik und der Erzeugung, und scin Planet hat sich, vi:illig im Gegensatz zur alten Mystik, die es mit fertigen, an sich iiberklaren Realitaten zu tun harte, noch nicht so weit gedreht, daf sich auch seine andere, sowohl uns wie sich selbst noch abgewendete Seite erkennen lielie. Wenn wir also fragten, was das Friihcr gewesen sci, in den hellseherischen, aber rnusiklosen Zeiten, was jetzt, in der Neuzeit, anfangt, als Musik zu erscheinen, urn eben dadurch zu erkenncn, wohin und zu welchern Ende Musik sci, so reicht die crkannte Verwandtschafl: des Hellsehens und dann der Musik doch nur zur Bestimmung des gemeinsamen Niveaus, aber weder zu der gewandelten Funktion noch gar zur Inhaltsangabe des weiter gezogenen Objekts aus. Es ware hier die schlimmste Ablenkung, wollte man wegen der Ahnlichkeit der beiden ki:iniglichen Wege auch das alte Ziel mit heriibemchrnen, wollte man also den insgesamt ti:inend geborenen Tag, den vordem nur Fiir Geistesohren tonend geborenen Tag, das ungeheure innere Himmelsbild der Musik, die uralt geahnte KlanghaA:igkeit der devachanischen Welt im Gegensatz zu der Farbenaura der bl06 astralischen Welt - wollte man also das breit, integriert, tonend aufgliihende Dunkel des gelebten Augenblicks nun trotzdem mit den Gestaltungen des Astralrnythos oder auch des noch halbastralischen Trinitatsmy ..
r60
thos bcvolkcrn. Sondern es kommt ein Anderes, Unnennbares, lI[)sere geheime HerrIichkeit seiber herauf; »doch gehen wir, cr,:;raut ist schon die Welt, die LuA: gekiihlt, der Nebel fallt, am Abend schatzt man erst das Haus«; und nicht ohne allcrtielsten Grund sind erst die Wirrnisse, die luziferischen und allch satanischen Zusammenstiirze alles Oberen, die paradox ycrf1nsterten Adventsnadite der Neuzeit zur Geburtsstatte der Mllsik geworden. Darin aber zur Geburtsstatte unseres eigenstc n, geschichtlich innerlichen Wegs: als der Erli:isung nicht nur vorn Leib, sondern von jeder blobcn Pf1icht und kahlen, blof zwischenmenschlichen Definierbarkeit, als der Loslosung von allem \'Verkwesen, von aller Transzendenz, in der der Mensch nicbt vorkommt; als der Losli:isung schlie61ich zu einer Ethik unrl Metaphysik der Innerlichkeit, der briiderlichcn 1nwendigk cit, der in sich selbst enthiillten Heimlichkeit, die die ganzlichc Sprengung der Welt sein wird und der Morgen der Wahrheir iiber allen vergehenden Grabern,
\Vir brauchen hier nicht zu fiirchten, cnttauscht oder gar betrogen zu werden. Es ist nicht mehr erlaubt zu sagen, da6 so wie die Traume vergehen, sobald man erwacht, so auch dasjcnige, was nur im 1ch lebt und sonst unbest atigt ist, unbedingt wcscnlos sein miisse. Das mag fur unsere kleinen Erregungen gelten; hicr mag es freilich scin, da6 allein das dicht urn uns gewirkelte Zudeck des Korpers uns die Qualen und Freuden des Icbcns zuspielt, Und wie wir schlafend untcr heriiberfallenden Bergcn zu erstickcn glauben, wenn das Deckbett sich auf unsere Lippcn iiberschlagt, so wirA: diese Erde, diescr Leib allerdings ll1 den siebz.igjahrigen Schlaf des Unsterblichen Lichter und K hnge und Kaltc, und er bildet sich daraus die vergrofserte Ccschichte seiner Leidcn und Freuden; und wenn er erwacht, ist nul' wenig wahr gcwescn, ja, cs la6t sich dies em Satz Jean Pa,Iis hinzufiigen, nichts davon ist wahr gewesen, das alles ist rd1cxiv und hat mit der sehnsiichtig bewegten Seele, die sich nichr nur vom Leib, sondern auch von jeder zwischen menschlichen Dcfinierbarkeit hinweghebt, nichts, nicht einmal den Get'c'nsatz gcmcin. \'Venn aber das, was der Ton sagt, von uns summt, sofern wir uns hineinlegen und mit diesem gr06en, Il1c1kanthrophischen Kehlkopf sprechen, so ist das nicht ein Tr:lum, sondcrn ein fester Seelenring, dem nur deshalb nichts
r6r
entspricht, wei I ihm drauflen nichts mehr entsprechen kann, und weil die Musik als innerlich utopische Kunst iiber alles ernpirisch zu Belegende im ganzen Umfang hinausliegt. Wir brauchen hier aber auch nichr darum besorgt sein, daf sich dieses Hohe und Bessere als wir nicht in uns zuriickbildcn mochte. So wenig wie wir vor der Musik, wie allerdings zumeist noch bei den bildenden Kiinstcn, cmport zu sein brauchen, daf hier etwa eine Sperre aufgerichtet ist und der Mensch dauernd nur von draufsen herein zu blicken und zu warren hat. Man braudit sich hier auch nicht damit zu trosten, scheinheilig zu trosten, daB wir unsere eigenen Tranen leichter verwinden als wir den namenlosen Jubel der Engel verwinden konntcn, und man braucht in das uns in der Musik geschenkte echte Symbol nicht erst noch mit vcrzweifelrcr Eifersucht einzubrechen wie in die bildnerischen Gleichnisse und das Symbolische alter Zeit. Die Domestikentiir bloBer Kontemplation ist gesprengt, und anderes als das allegorische Symbol erschcint, wie cs mcnschenfremd, zum mindesten halb auBermenschlich war, das uns, wenn es ganzlich sichtbar geworden ware, gleich dem ungemilderten Zeus erdriickt, verbrannt harte, und dessen im Sichtbaren, uns Zugeneigten imrner noch ungeloste transzendente UnfaBbarkeit gerade seinen Symbolcharakter konstituiert harte, Als seinen nur falschlichcn, nur fur uns bestehenden, allegorischen Symbolcharakter, hinter dem doch, wie in .Agypten, zwar unser eigenes Dunkel, aber auch die todliche Klarheit des Irrturns, des Frcmdlichts, des Astralmythos wohnt. Aber der Ton geht mit uns und ziehr sich nicht am Ende in seine uns fremde oder gar verbotene Heimat allegorisch zuriick. Wenn das Tonhafte nur andeutend, noch uneigentlich bleibt, so ist es nicht etwa in Zeichen gestellt, so will uns seine Ratselsprache nidits i.iberirdisch schon Gelostes verbergen, sondern die Funktion dec Musik isr vollste Offenheit, und das Geheimnis, das verstandlich-Unverstandliche, das Symbolische an ihr ist der eigcnc, sich selber sachlicb verhiillte Menschengegenstand selber. Der Ton geht mit uns und ist Wir, nicht nur so wie die bildenden Kiinste bloG bis zum Grabe mitgehen, die doch vorher so hoch iiber uns hinaus ins Strenge, Objektivc, Kosmische zu wei sen schienen, sondern wie die guten Werke auch noch tiber das Grab hinaus mitgehen; und zwar gerade deshalb, weil das Erhabene der
162
Musik, das neue, nicht mehr padagogische, sondern reale Symbol in der Musik so sehr niedrig, so sehr nur bloBer feuriger Ausbruch in unserer Atrnosphare scheint, obwohl es doch ein Licht am fernsten, allerdings inncrsten Fixsternhimmel, ja das Sclbst- und Wirproblem selber ist. Der gestaltete Klang bleibt so kcin Gegeni.iber, sondern es ist etwas in ihm, das uns die Hand aufs Herz legt, das uns mit uns seiber bcschwort, umsrcllt und derart unsere bediirftige, ewige fragende Rezeptivitat mit sich selbst, zum mindesten mit ihrer unabgelenkten, rein gewordenen, als sie selbsr widerhallenden Frage nach der Heimat be.int wortet. So schafft der Ton sowohl einen i.iberrealen als auch cinen unallegorischen, nur hinsichtlich der nodi bestehenden Unvollendung seiner Ichornamentik symbolischen Bedeutur.gsk reis des menschlich an Menschen Intuitionierbaren, der absr.indslosen, speciesi.iberlegenen Gnosis des Wirproblems ubcrhaupt,
Mithin : das Hellsehen ist langst erloschen, Sollte aber nicht cin Hcllhoren, ein neues Sehen von inn en im Anzug sein, das nun, '.'10 die sichtbare Welt zu unkraflig geworden ist, den Geist zu Inltcn, die horbare Welt, die Zuflucht des Lichts, den Primat des Entbrennens statt des bisherigen Primats des Schauens herbciruft, wann immer die Stunde der Sprache in der Musik gek ommcn sein wird? Denn dieser art ist noch leer, er hallt in den rncraphysischen Zusarnrnenhangcn nur erst dunkel wider. i\ber es wird einc Zeit kommen, wo der Ton spricht, ausspricht, \\0 die wahren Leuchter endlich in das obere Ich eingestellt werden, wo das, was Brangdnen noch wie Hornerschall klingt, l sold» im Schweigen der Nacht als Quell hart, wo die neuen :\[usikcr den neuen Propheten vorhergehen werden; und so wollcn wir den Prirnat cines sonst Unsagbaren der Musik anweiscn, diesem Kern und Samen, diesem Widerschein der bunten Stcrbenacht und des ewigen Lebens, diesem Saatkorn zum innercn mystischen Meer des Ingesindes, diesem Jericho und crstcn Wohnort des hciligen Landes. Wenn wir uns nennen kiinnrcn, kame unser Haupt, und die Musik ist die cinzige subjcktiyc Theurgie. Sie bringt uns in die warmc, tiefe, gotische Stubc des Innern, die allein noch mitten in dem unklaren Dunkel leuchtet, ja aus der allcin noch der Schein kommen kann, cler das Wirrsal, die unfruchtbare Macht des blof Seienden,
163
das rohe, vcrfolgungssiichtige Tappen der dcrniurgischen Blindheir, wenn nicht gar den Sarg des gottverlassenen Seins selber zuschanden zu machen und auscinander zu sprengen hat, da nichr den Toren, sondern den Lebcndigcn das Reich gepredigt wurde, und so eben diese unsere kaum gekannte, warme, tiefe, gotische Stube am jungsten Morgen dassel be wie das offenbare Himmelsreich sein wird,
Zur Dreigroschenoper
Schr viele sprach diese besonders heiter an. Sie hatten vergntigten Ulk, nahmen ihn mit nach Hause. Schlager dazu, stille und b.ttcre, merkwtirdig gescharfte, doch nicht angreifend. Dies Un"ci:ihrliche scheint dort vor allem, wo der Burger lacht, Die SchLcger scheinen diesel ben, die er auch sonst tanzt, nur besser zubcrcitct. Und die Bettlcr schein en mit ciner Lage einverstanlim, die sie so lustig noch singen und spiel en Hillt. Zum frischen 'fan tanzt manches, das es nicht notig harte.
Alles richtig, doch mit dem frisch en Ton ist es wieder nicht so wcit her. Weill gelang eher, auf sehr lebendige Art, die faulen \V~1sscr auszuschopfen, gerade die des Schlagers. »Anstatt daf], anst att dall sie zu Hause bleiben, brauchen sie Spafi«: die fa 1- schr n Tone, versetzten Rhythrnen dieses Spafses werden auskomponicrt und cnthullt, Dadurch wird die Triebbefriedigung, die das Publikum sonst an Schlagern findet, verraten und verritcrisch umgesetzt; narnlich die Ware als Schlager hort auf, und er erscheint als verhinderter Ersatz fur cin Gut. Weill errcichte in leichter, ja vulgarer Maske viele, an die die vergescnritt cne Musik nicht herankam. Sind diese Vielen auch nur zum kleinstcn Teil Proleten, so macht sich Weill aus dem besscrcn Klassengemisch, das zuhort, doch nicht -ven«, das zu sin~cn ware, sondern Zersetzung, die der leichten Musik bis aut den Grund geht. Weill ist nicht radikal cintonig und genau \\'Ie Eisler, erst recht nichr »musikanrisch«, narnlich falsch unmiuclbar, wie die sozialdernokratische Urnatur Hindemith; er n.mmr noch weniger den Schlager in Songgestalt auf, als ware cr cin neues Volkslied. Ist er doch langst industrialisierte Ware; gcrade der neue, aus armen Negern und eleganteren Urgefuh-
wurde besonders genormt und abgehoben, besonders anonYlll lind gegenstandslos in seiner Triebbefriedigung. Doch ei]cnso ist irn Schlager ein Seitensprung, cin Snick Hurengassc ulld J uxkabinett neben der Prachtstrafie; macht der Schlager als Rhythmus, Melodic und Text auch vdllig den genormten Zeitzug mit, so hat cr darunter noch cin schicfes Gesicht, ein ko! portagchafl:es, das mit grolltcr Oberflachlichkeit die Oberfhchcn sich abschminkt. Das Lumpcnhafl:e desSchlagers bewirkt
165
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (20018)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyFrom EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyRating: 4 out of 5 stars4/5 (3321)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksFrom EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (19653)
- Wuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)From EverandWuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (9486)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5794)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceFrom EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceRating: 4 out of 5 stars4/5 (2556)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleRating: 4 out of 5 stars4/5 (2566)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleRating: 4 out of 5 stars4/5 (353)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionRating: 4 out of 5 stars4/5 (2475)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionFrom EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionRating: 4 out of 5 stars4/5 (12945)
- How To Win Friends And Influence PeopleFrom EverandHow To Win Friends And Influence PeopleRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (6520)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationFrom EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationRating: 4 out of 5 stars4/5 (2499)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionFrom EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionRating: 4 out of 5 stars4/5 (2507)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (3275)
- The Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderFrom EverandThe Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderRating: 4 out of 5 stars4/5 (5718)
- The Picture of Dorian Gray (The Original 1890 Uncensored Edition + The Expanded and Revised 1891 Edition)From EverandThe Picture of Dorian Gray (The Original 1890 Uncensored Edition + The Expanded and Revised 1891 Edition)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (9054)
- The Picture of Dorian Gray: Classic Tales EditionFrom EverandThe Picture of Dorian Gray: Classic Tales EditionRating: 4 out of 5 stars4/5 (9756)
- Wuthering Heights Complete Text with ExtrasFrom EverandWuthering Heights Complete Text with ExtrasRating: 4 out of 5 stars4/5 (9929)
- The Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)From EverandThe Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (7770)
- The Iliad: The Fitzgerald TranslationFrom EverandThe Iliad: The Fitzgerald TranslationRating: 4 out of 5 stars4/5 (5646)